Unser diesjähriges «Schönauer Stromseminar» fand unter dem Motto «Die Zukunft liebt Rebell:innen» ganz im Zeichen von gleich zwei Jubiläen statt – 30 Jahre EWS und 15 Jahre Genossenschaft. Anlässlich dessen hat Dr. Andreas Wieg, Leiter der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (DGRV), über die große Bedeutung von Energiegenossenschaften wie die EWS für die Energiewende gesprochen. Dabei hob er hervor: «Unsere Story ist wirklich, Widerstände in den Köpfen abzubauen, zu gestalten und etwas aktiv zu machen. Und davon sollten wir auch wirklich nicht abweichen.» Die Festrede stellen wir Ihnen etwas weiter unten zur Verfügung.
Zur Person Dr. Andreas Wieg

Dr. Andreas Wieg ist eine Schlüsselfigur in der deutschen Energiegenossenschaftslandschaft. Als Wirtschaftswissenschaftler leitet er die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV in Berlin. In dieser Position fungiert er als wichtiges Bindeglied zwischen den rund 1.000 Energiegenossenschaften hierzulande und der politischen Ebene. Seine Expertise erstreckt sich weit über die nationalen Grenzen hinaus. Denn als Vorstandsmitglied des europäischen Dachverbands der Energiegenossenschaften «REScoop.eu» bringt er die deutsche Perspektive in den europäischen Diskurs ein und fördert den länderübergreifenden Austausch zu Bürgerenergie-Projekten.
Interview mit Dr. Andreas Wieg vor seiner Festrede
Wenn Sie uns in 30 Jahren wieder besuchen und wir dann 60 Jahre alt werden. Was meinen Sie: Wie sieht die Welt dann aus?
Ich hoffe, dass die genossenschaftliche Idee, so wie sie heute lebt, in Zukunft auch noch leben wird. Vor allen Dingen durch so positive Beispiele wie die EWS.
Was ist das Rebellische an der genossenschaftlichen Idee?
Ich weiß nicht, ob ich die genossenschaftliche Idee unbedingt mit Rebellion und Rebellentum gleichsetzen würde. Aber es gibt etwas, was viele genossenschaftliche Projekte gemeinsam haben, gerade, wenn sie neu gegründet werden: Meistens geht es darum, Widerstände zu überwinden. Das kann man rebellisch nennen.
Ich würde es einfach Zukunftsgestaltung nennen. Denn es geht darum, gemeinsam etwas anzupacken, gemeinsam etwas positiv zu verändern. Das kann in der Energiewende sein mit einer Energiegenossenschaft. Das kann in meiner Heimatregion sein, dass man gemeinsam eine Gesundheitsversorgung unterstützen möchte. Dass man vielleicht in ein Wohnungsprojekt gemeinsam einsteigen möchte oder vielleicht ein anderes Thema der ländlichen Infrastruktur angeht, wie ein Schwimmbad, ein Dorfgasthaus oder einen Dorfladen.
Video der Festrede von Dr. Andreas Wieg vom 28. Juni 2025
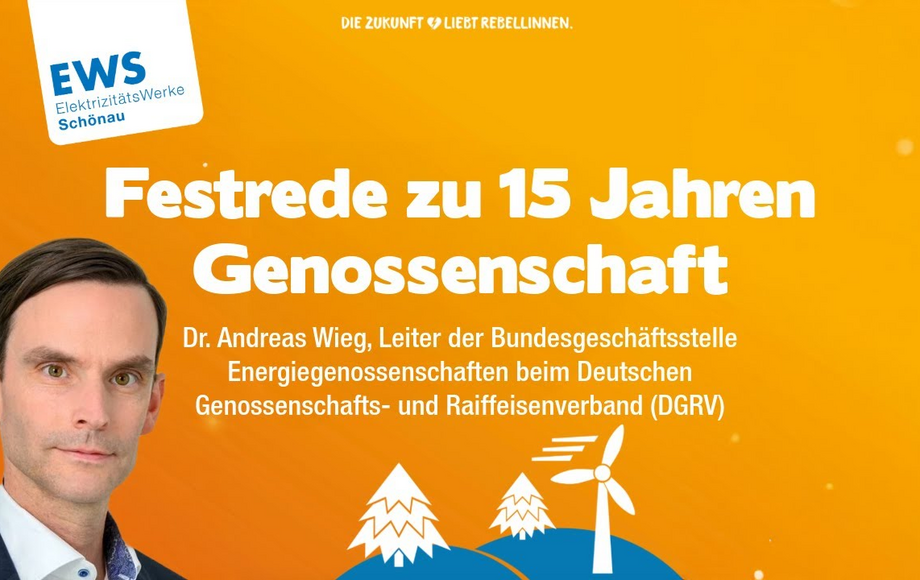
Ja, ich möchte Inhalte von YouTube angezeigt bekommen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Festrede von Dr. Andreas Wieg im Wortlaut
Ja, liebe Frau BEE-Präsidentin, liebe Simone Peter, lieber Herr Jorberg und lieber Vorstand der EWS – danke Armin [Komenda] für die Anmoderation und vor allen Dingen liebe Mitglieder der EWS – ganz herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Jubiläumsstromseminar. Ich bin zum ersten Mal im wunderschönen Schwarzwald. Ich habe leider nur ein paar Minuten gestern Abend und heute Morgen davon genießen können. Und als ich es gestern mit dem Taxi dann doch noch zu Ihrer Generalversammlung geschafft habe, habe ich mit dem Taxifahrer ein Gespräch angefangen. Und normalerweise unterhält man sich ja über das Wetter und die letzten Fußballergebnisse. Wir haben intensiv darüber diskutiert, wie man mit dem weiteren Windausbau das Rentensystem stabilisieren könnte. Ich habe in dem Moment auch gedacht, du musst dich besser vorbereiten.
Auf jeden Fall ist mir klar geworden, ich bin hier im Territorium der EWS offensichtlich angekommen. Denn das ist mir in Berlin und sonst wo noch nirgendwo passiert. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum. Das ist wirklich eine großartige Sache. Die EWS sind wirklich eine Pionierleistung. Ich hätte jetzt wirklich den Geschichten und den Meilensteinen noch ewig zuhören können. Und wir profitieren enorm in unserer Lobbyarbeit in Berlin, dass wir eben so tolle Genossenschaften haben, so tolle Storys haben. Armin [Komenda], wir tauschen uns ja wirklich sehr eng miteinander aus und wir profitieren da wirklich sehr in unserer Positionsfindung und was wir dann letztendlich gegenüber der Politik auch artikulieren.
Und ich möchte natürlich nicht verschweigen, dass wir auch sehr froh sind, schon sehr, sehr lange auch beim BEE Mitglied sein zu dürfen. Wir sind kein Energieverband, aber es ist schon sehr wichtig für uns, dass wir auch mit am Puls der Diskussion sind und da wirklich auch für die Energiegenossenschaften was machen können. Und als ich gefragt wurde, Mensch, Andreas, du kannst doch bei uns eine Festrede halten, dachte ich, oh, Festrede. Was soll ich euch um Himmels willen denn erzählen? Und da es ein Jubiläums-Event ist von Ihnen, dachte ich, Mensch, dann mache ich was Persönliches. Ich habe vorhin keinen Hut gefangen und der Vorteil von mir gegenüber Ihnen ist jetzt, dass ich nicht fünf Minuten habe, sondern eben ein paar Minuten mehr, um meine persönliche Geschichte hier auszubreiten, wie ich denn zu dem Thema Energiegenossenschaft und auch zu der Zusammenarbeit mit den EWS gekommen bin.
Ich habe es mal überschrieben mit der Überschrift «Rebellion im Stromsystem» und würde gerne damit beginnen, Ihnen nochmal vorzustellen, was ist das eigentlich, DGRV, Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband? Wir sind in Berlin ansässig und wir kümmern uns um die übergreifende politische Interessenvertretung für die Genossenschaften. Sie haben ja hier – der Armin Komenda hat es gerade ja gesagt – in Baden-Württemberg den baden-württembergischen Genossenschaftsverband, der Sie betreut, prüft und Beratungsangebote bereitstellt. Wir in Berlin kümmern uns um übergreifende Themen, da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen, unter anderem, dass das Genossenschaftsgesetz beispielsweise so ausgestaltet wird, dass sich das nicht mit dem EEG beispielsweise beißt.
Das ist etwas, von dem Sie wahrscheinlich relativ wenig mitbekommen, ist für uns aber eine Daueraufgabe: Dass die gesetzlichen Regelungen, die es für unsere Rechtsform gibt, aber auch eben mit der Energieregulierung, dass das zusammenpasst. Wir vertreten die 5.150 Genossenschaften aller Branchen, insbesondere um das Genossenschaftsrecht, aber auch um kaufmännische Fragen wie Rechnungslegung, Prüfung und dergleichen. Wir alle gemeinsam haben eine sehr lange Tradition aus der Mitte des 19. Jahrhunderts kommend und wir kokettieren immer etwas mit der Aussage, wir sind die mitgliederstärkste Wirtschaftsorganisation Deutschlands, auch dank der 14.000 Mitglieder der EWS. Und wir haben schon was zu sagen in diesem Land.
Das ist aber nicht alles. Wir haben beim DGRV eine Bundesgeschäftsstelle für die Energiegenossenschaften, die sich konkret um die Energiegesetzregelung auch kümmert. Wir machen das in Berlin, wir machen das aber auch in Brüssel. Es ist gerade angesprochen worden, es gibt einen europäischen Dachverband der Energiegenossenschaften, REScoop.eu, wo ich auch im Vorstand mitwirken darf. Also vieles, was von Europa kommt, in den Richtlinien drinsteht, ist wirklich über diesen kleinen, relativ neuen Verband auch mit beeinflusst. Und da wird wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Wir machen Lobbyarbeit, um es kurzzufassen, und kümmern uns natürlich auch um die Weiterbildung von Geschäftsmodellen und machen auch ein bisschen internationale Projektarbeit.
So, kommen wir mal zum Thema, zur Überschrift Ihres Seminars heute: Die Zukunft liebt Rebell:innen. Und 30 Jahre EWS-Jubiläum, 15 Jahre Genossenschaftsjubiläum. Mir ist im Vorfeld aufgefallen, huch, ich habe ja auch persönlich zwei Jubiläen dieses Jahr. Das eine ist, ich bin seit 25 Jahren im und für das Genossenschaftswesen tätig und seit 20 Jahren beim DGRV. Und da kommt schon die erste Verbindung. Da ist ein ganzes Stück gemeinsame Wegstrecke, die da passiert ist. Ich habe mir aber nochmal genau angeguckt. Ich kenne natürlich Ihren Stromrebell:innen-Ansatz schon viele Jahre. Ich bin aber nochmal wissenschaftlich rangegangen und habe geguckt, Mensch, was sind eigentlich ein Rebell und eine Rebellin? Ich habe dann mal bei Wikipedia geschaut und da steht dann: Ein Rebell ist jemand, der an einer individuellen oder kollektiven Rebellion beteiligt ist. Also meine Studis würden in einer Klausur für so eine Antwort null Punkte bekommen.

Rebell, Rebellin mit Rebellion zu erklären, ist natürlich nichtssagend. Aber es geht im Wesentlichen um Widerstand, Widerstand gegen etwas. Interessanterweise aber auch gegen Widerstände. Das ist eigentlich unsere Story, die bei den Bürgerenergiegenossenschaften drinsteckt. Also nicht nur gegen etwas, sondern eben auch gegen Widerstand. Und in der Frage würde ich jetzt ein bisschen näher vorangehen. Also 20 Jahre oder 25 Jahre Kontakt mit dem Genossenschaftswesen und 20 Jahre dann eben beim DGRV. Und alles begann in Marburg an der Universität, als ich nach dem Studium das Angebot bekommen habe, Sie dürfen am Institut für Genossenschaftswesen, wir haben hier eine Stelle für Sie, da dürfen Sie Ihrem Promotionswunsch nachgehen, schauen Sie sich mal um.
Und dann war ich da so an meinen ersten paar Arbeitstagen in dem Institut für Genossenschaftswesen. Und ging dann so durch die Bibliothek, mein Arbeitsplatz war auch an der Stelle. Und dann fand ich so ein Buch, Leitfaden zur Genossenschaftsbuchhaltung. Na ja, ob das jetzt so dein Schwerpunkt werden wird? Dann habe ich so ein bisschen weiter gegraben, da bin ich auf das Buch gestoßen «Die Frau und das Genossenschaftswesen», alles aus den 1920er Jahren. Es ist wirklich nicht so schlimm, wie Sie es jetzt vermuten würden. Ich habe tatsächlich noch mal reingeschaut, sondern mal abgesehen von dem Rollenverständnis vor 100 Jahren, wird erstaunlich viel über das selbstständige, eigenverantwortliche Wirken von Frauen in Konsumgenossenschaften geschrieben. Also durchaus progressiv zu lesen.
Und dann gab es noch den Wiederaufbau des Reblaus verseuchten Weinanbaugebietes im Heimbachtale. Und da habe ich dann doch mal ein bisschen länger durchgestöbert, was ist da eigentlich an der Story dran? Und wenn man mal beim Genossenschaftsthema einsteigt, es lässt einen einfach nicht mehr los. Die Story, dass man Widerstände zu überwinden hat, dass man eigentlich ausweglose Situationen hat und es doch eben gemeinsam hinbekommt, da den nächsten Schritt zu machen. Das ist in dem Weinanbaugebiet damals gelungen. Das ist aber in den vielen tausend anderen Geschichten, die Sie in so einer Bibliothek nachlesen können, immer wieder die gleiche Story gewesen.
Also, infiziert von dem Genossenschaftsgedanken nach meiner Zeit am Institut für Genossenschaftswesen bin ich dann vor gut und gerne 20 Jahren im Herbst 2015 zum DGRV gekommen. Und ich weiß es noch ganz genau, in der ersten Sitzung des Arbeitskreises Neue Genossenschaften, wo die Fachberaterinnen und Fachberater aus den Regionalverbänden zusammenkommen, war eines der ersten Themen, die wir hatten: Es werden Energiegenossenschaften gegründet. Was ist das denn? Und man fing plötzlich unter den wirklich sehr engagierten Beraterinnen und Beratern an, ich habe da über die Jahre viel, viel gelernt. Aber ich habe dann wirklich in der ersten Sitzung gedacht, wieder gedacht, wo bist du denn hier gelandet? Sind das überhaupt Genossenschaften, diese Energiegenossenschaften? Und da ist eine Frage diskutiert worden, die viele Jahre später tatsächlich nochmal gesetzliche Realität werden sollte, dass das eine entscheidende Frage sein kann. Haben wir hier überhaupt Mitgliederförderung und ist das überhaupt das, was das Genossenschaftsgesetz vorsieht?
«Energiegenossenschaften können im Grunde alles, wenn man sie nur lässt.»
Also, das ist mein persönlicher Bezugspunkt. Vor 20 Jahren ging es los mit dem energiegenossenschaftlichen Thema, unter anderem ebendiese Fragestellung, ob das nun Genossenschaften sind oder nicht. Und Sie sehen, der statistische Zusammenhang ist eigentlich eindeutig zu sehen. Ich habe 2005 angefangen und seitdem ging das rasant nach oben mit den Energiegenossenschaftsgründungen. Es war eher der glückliche Umstand wirklich für mich persönlich, dass ich die Chance bekommen habe, Mensch, du kannst an so einem Thema weiterarbeiten und was steckt da für ein Potenzial drin? Und über 1.000 Energiegenossenschaften haben wir in Deutschland. Das sind die Gründungszahlen dazu mit Auf und Abs, aber doch wirklich immer mit einer Kurve nach oben. Was machen die Energiegenossenschaften? Ich gehe da jetzt an dieser Stelle nur ganz kurz drauf ein.
Sie sehen, Energiegenossenschaften können im Grunde alles, wenn man sie nur lässt. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei der Erzeugung erneuerbarer Energien, vor allen Dingen im PV-Bereich, aber es gibt natürlich den Netzbetrieb, logisch, es gibt aber auch den Wärmenetzbetrieb, es gibt Carsharing-Angebote und vieles mehr, was Sie übrigens in unserer Statistik noch viel ausführlicher auf unserer Website dann nachlesen können. Und eine der wichtigsten Folien oder Statistiken, die ich immer wieder zitiere, wenn es darum geht, was ist das eigentlich mit dem Energiegenossenschaftsthema, ist diese Folie hier. Nämlich die Frage nach der Mindestbeteiligung und auch der tatsächlichen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den 1.000 Energiegenossenschaften. Was ist denn da die durchschnittliche Zahl?
Und Sie sehen es, bei 70 Prozent der Genossenschaften brauchen sie bis maximal 500 Euro, um da Mitglied zu werden. Das sagt diese Übersicht aus. Das heißt, eine Mitgliedschaft scheitert nicht am Geld. Genossenschaften, Energiegenossenschaften sind so angelegt, dass möglichst jeder mitmachen kann. Die durchschnittliche Beteiligung, also was tatsächlich bundesweit gerechnet über die 1.000 Genossenschaften an tatsächlicher Beteiligung ist, sehen Sie, das sind 3.600 Euro. Ich habe das gestern im Taxi auch angebracht, dass wir damit nicht das Rentensystem stabilisieren werden. Es zeigt vor allen Dingen aber auch, die Beteiligung an den Energiegenossenschaften ist keine Kapitalanlage und es ist auch wirklich nichts für die persönliche Geldanlage, im Schwerpunkt jedenfalls nicht, sondern es geht um was anderes, nämlich Beteiligungen.
Und dass die Entwicklung der Energiegenossenschaften so stattgefunden hat, mit Auf und Abs in den Gründungszahlen, mal stärker, mal weniger, hängt natürlich ganz extrem an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und wir haben die Geschichte der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften mal vor einigen Jahren in so einem Zeitstrahl der politischen Entscheidungen, der Gesetze, die herausgekommen sind, an denen wir mitgearbeitet haben, auch wie gesagt, dank eurer Unterstützung, eures Praxischecks, ausgewertet. Da kommen wir an einer ganzen Menge an Energie- und EEG-Novellen und Förderprogrammen für Bürgerenergiegesellschaften etc. vorbei. Vor allen Dingen aber, ich habe es etwas hervorgehoben, an einem Kapitalanlagegesetzbuch und auch einem Vermögensanlagegesetzbuch. Und da habe ich dann zehn Jahre später die Bestätigung bekommen, meine Beraterkolleginnen und -Kollegen bei meinem Einstiegsarbeitskreis «Neue Genossenschaften», die hatten vollkommen recht. Das ist eine Fragestellung.
Wie fördern eigentlich die Energiegenossenschaften ihre Mitglieder? Und damals wurde das eben in der Umsetzung einer europäischen Richtlinie, einer Richtlinie für die Regulierung von alternativen Investmentfonds, dieses Kapitalanlagegesetzbuch erlassen und das hätte, um es wirklich sehr kurz zu fassen, die Bürgerenergiegenossenschaften, die ehrenamtlich betriebenen Bürgerenergiegenossenschaften vor riesengroße Herausforderungen gestellt, wenn das wirklich langfristig in der Anwendung geblieben wäre. Und ich war selber in Gesprächen mit der BaFin dabei. Sie glauben gar nicht, was sie für Gespräche führen, um zu erklären, was eine Genossenschaft ist und was ein Investmentfonds ist.
Also das ist wirklich sehr, sehr mühselig. Wir haben es aber hinbekommen. Genossenschaften sind aus diesem Kapitalanlagegesetzbuch wieder herausgenommen worden. Und auch die BaFin hat ihr Auslegungsschreiben dahingehend geändert, dass es sich bei einer Genossenschaft eben nicht um einen Investmentfonds handelt. Ich verkürze das jetzt hier sehr stark. Aber wir müssen aufpassen. Genossenschaften dürfen eben nicht zu Kapitalsammelstellen werden, also in der praktischen Anwendung. Das ist das, was wir an politischer Arbeit in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist wie im Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, Sie sehen es, jetzt geht es gerade wieder weiter mit den nächsten Themen, die wir haben, also all das, was im Koalitionsvertrag drinsteht und das, woran wir schon länger arbeiten.
Ich will hier nur herausgreifen: Das Thema Energy Sharing steht da in der Mitte, also die gemeinschaftliche Erzeugung und der gemeinschaftliche Verbrauch von Strom, von Energie. Ein riesengroßes Thema und eigentlich auch ein Schlüsselthema für die genossenschaftsrechtliche Fragestellung. Wie fördern eigentlich die Genossenschaften ihre Mitglieder? Indem sie am besten natürlich den selbst erzeugten Strom ihnen bereitstellen. Das ist Energy Sharing. Nur dieses eine Thema vielleicht herausgegriffen und Sie sehen es in der letzten Zeile wieder, das ist ganz typisch, es ist ein Großteil meiner Arbeit, da aufzupassen, jetzt steht wieder eine Novellierung des Genossenschaftsgesetzes an. Was wird denn da vorgeschlagen, was wird da diskutiert? Und am Dienstag kam der Referentenentwurf und es steht drin, dass eine Klarstellung im Paragraf 1 kommen wird, dass Genossenschaften ihre Mitglieder nicht nur unmittelbar, sondern auch mittelbar fördern können, was insbesondere für Energiegenossenschaften mehr Rechtssicherheit schaffen wird, insbesondere wenn man sich eben an Windprojekten beteiligen möchte.
Ich gehe jetzt da nicht ins Detail. Das wäre, wie gesagt, noch mal eine eigene Session, darüber wirklich zu sprechen, was das auch für Konsequenzen hat. Es ist aber wirklich ein Meilenstein in der Entwicklung dieses Gesetzes. Da wird am Paragraph 1 was geändert. Ich kann vielleicht verraten, wir hatten einen anderen Vorschlag, um dieses Beteiligungsthema einzufangen. Wir wollten neben den ökonomischen, also den wirtschaftlichen, den kulturellen und sozialen Zwecken, denen Genossenschaften nachgehen können, auch den Klimaschutz als vierte Kategorie einführen. Sind daran leider gescheitert. Das wäre eine sehr elegante Lösung gewesen. Das hätte man auch sehr gut öffentlichkeitswirksam sicherlich verkaufen können. Aber rechtspraktisch und auch rechtstheoretisch passt das natürlich besser, so wie wir hier unterwegs sind. Also das wird am Ende das gleiche Ergebnis sein.
Da sind wir gerade dran, wieder Stellungnahmen und dergleichen auszuarbeiten, um eben da wirklich auch diesmal die passende Änderung hier im Genossenschaftsgesetz durchzubekommen. Das, was wir der Politik eben erzählen, die Position, die wir vorbereiten, das findet meistens in geschlossenen Räumlichkeiten statt, klar. Manchmal machen wir das aber auch Quora im Publikum, wie Sie hier sehen. Wir richten jedes Jahr einen Bundeskongress Genossenschaftliche Energiewende in Berlin im Haus der DZ Bank am Pariser Platz aus. Und auch an der Stelle nochmal ein Extradank, insbesondere Armin Komenda, dass wir Euch, die EWS, als langjährigen Veranstaltungspartner damit dabeihaben und dadurch auch wirklich hier immer ganz tolle Veranstaltungen durchführen können.

Ich habe mal den Schuhkarton unterm Bett vorgezogen und mal die ganzen Fotos rausgesucht, die im Laufe der Jahre von diesem Bundeskongress geschossen worden sind. Da war eine ganze Menge Politprominenz auf der Bühne und auch eine ganze Menge an Ihren Kolleginnen und Kollegen von den EWS, die uns immer wieder auch im Programm bereichert haben oder auch am Ausstellungsstand jetzt bereichert haben. Dass kein falscher Eindruck entsteht, es waren auch andere Gäste als die EWS da, aber es ist auch immer wieder schön zu sehen im Rückblick, dass wir da wirklich sehr lange eine tolle Partnerschaft haben und uns eben auch gemeinsam zu zeigen.
Also das war das Thema gesetzliche Rahmenbedingungen. Ja, die braucht man natürlich, sonst kann so eine Entwicklung nicht stattfinden. Gesetzliche Rahmenbedingungen, um Widerstand zu leisten. Das beißt sich so ein bisschen, weil man ja eigentlich gegen das System arbeiten möchte und braucht aber gleichzeitig natürlich die entsprechenden systemischen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und das Faszinierende an der Genossenschaftsstory ist, Sie sind hier nicht allein mit Ihrer Genossenschaft. Es gibt überall in Deutschland Energiegenossenschaften. Es gibt überall in Europa oder in vielen Ländern Energiegenossenschaften und das Genossenschaftsthema an sich ist weltweit verbreitet.
Meine Frau und alle Familienangehörigen sind immer wieder angenervt, wenn es auf eine Urlaubsreise geht, also grundsätzlich, aber auch im Besonderen. Und wir sind in der Toskana beispielsweise, gehen auf dem Marktplatz dann spazieren und da gibt es dann ein Geschäft der örtlichen Kunsthandwerker. Und der übliche Tourist, die übliche Touristin, geht in diesen Kunsthandwerkladen rein und guckt, Mensch, wie teuer ist denn jetzt das Schachbrett da aus Alabaster. Ich gehe in so einen Laden rein und frage dann in dem Showroom den Handwerker, na, wie war denn eure letzte Generalversammlung? Ich Genossenschaft, du Genossenschaft und sofort hat man etwas miteinander zu erzählen und es war ein riesiger, glücklicher Umstand, ich habe es Ihnen ja gerade eingangs gesagt, mit meinem persönlichen Jubiläum, dass meine Arbeit beim DGRV auch für die Energiegenossenschaften überhaupt mit der Energiewende zusammengefallen ist.
Und es gab ein weltweites riesengroßes Interesse, das ist noch gar nicht so lange her, Anfang der 2010er Jahre. Mensch, was machten denn ihr da in Deutschland mit der Energiewende und was soll das mit diesen Energiegenossenschaften? Und ja, Sie sehen es da, also da hat es mich um die ganze Welt verschlagen und es kam immer wieder die Frage, wie fördern wir denn erneuerbare Energien und ist die Einspeisevergütung das richtige Instrument – egal ob Sie in dem ostasiatischen Kulturkreis sind, Sie sehen es da in Japan, ob das jetzt in Südamerika, in Mexiko, in Kanada ist oder jetzt zuletzt war ich in Korea, der Herr da im vorletzten Bild ist der Präsident des koreanischen Umweltinstituts. Und auch er fing an zu fragen, Mensch, wie sieht es denn aus mit eurer Regulierung?
Und ich weise immer wieder darauf hin, das ist doch gar nicht die Story. Oder es ist nur ein Teil der Story, weil Energiewende etwas Technisches ist, aber es ist auch etwas Soziales, etwas Zwischenmenschliches. Man muss eben die Menschen mitnehmen bei so einem enormen technischen Wandel. Und jetzt geht es ganz schnell, ich sehe schon die mahnenden Blicke. Und ich habe das immer versucht, Mensch, mit den sprachlichen Barrieren, wie erklärst du das Leuten im Ausland, was hier passiert und was hier vor allen Dingen für sie selber wichtig ist. Ich habe es dann mal so probiert. Also Genossenschaft. Es geht um die Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen, aber es geht jetzt nicht um Technik.
Und wenn man sich mal das 19. Jahrhundert anguckt, wenn man über Industrialisierung, bei uns die später stattfindende Industrialisierung im 19. Jahrhundert, anschaut, man redet immer über die bahnbrechenden Innovationen. Eisenbahn, Glühbirne, Telefon, was es nicht alles gegeben hat. Weitaus weniger wird darüber diskutiert, dass es auch soziale Innovationen gibt. Also Innovationen, die versucht haben, die negativen Folgen der Industrialisierung aufzufangen. Auch damals schon ein Thema. Schulze-Delitzsch mit dem Museum, der Robert Owen in Rochdale bei Manchester für die Konsumgenossenschaften und natürlich Friedrich Wilhelm Raiffeisen da in Flammersfeld. Das waren alles Pioniere, die eben geguckt haben, Mensch, wie können wir in der Gemeinschaft etwas erreichen, was einer alleine nicht schafft?
Auch das könnten wir jetzt wieder wunderbar vertiefen. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal die Frage gestellt haben, wenn im Westerwald alle Bauern, die Betriebe, die es dort gibt, alle das Problem des Kapitalmangels haben, alle zur gleichen Zeit. Es wird zur gleichen Zeit ausgesät und zur gleichen Zeit geerntet. Und die haben alle kein Geld, alle überschuldet. Wie im Himmelswillen gründe ich da gemeinsam eine Bank? Haben sie hinbekommen. Und da waren etliche Widerstände dabei, die man überwinden musste.
Die genossenschaftliche Story ist wirklich die Überwindung von Widerständen. Auch dazu habe ich jetzt zuletzt auch noch mal ein buntes Bildchen. Das versuche ich immer, wenn ich in Korea unterwegs bin, zu erklären und auch überall. Woher kommt dieser Widerstand? Die Menschen sind alle heimatverbunden. Das brauche ich Ihnen hier im Schwarzwald nicht erklären. So sieht es bei mir zu Hause aus. Da, wo ich herkomme, im Thüringer Wald. Ist ein bisschen niedriger, aber es sind durchaus ähnliche Landschaftsbilder. Und die Menschen sind stolz auf ihre Region, sie sind heimatverbunden, stolz ist ein starkes Wort, aber sie sind heimatverbunden und die Heimatverbundenheit macht man natürlich üblicherweise am Essen fest. Ich entschuldige mich schon jetzt bei allen anwesenden Vegetarierinnen und Vegetarier, aber wenn man aus Thüringen kommt, kommt man leider an der Bratwurst nicht vorbei.
«Die genossenschaftliche Story ist die Überwindung von Widerständen.»
Und ich habe dann, das sind übrigens, wie gesagt, die Originalbilder, die ich dann auch in Korea gezeigt habe, deswegen noch die Übersetzung dazu. Und dann habe ich mir gesagt, wie bringst du diese Heimatverbundenheit, dieses, ich habe da was, wie bringst du das rüber? Und dann habe ich mich hingestellt und habe ein koreanisches Sushi hergestellt, was Sie unten links in der Ecke sehen und da ist eine halbe Bratwurst, Thüringer Rostbratwurst drin. Also, es funktioniert bei Ihnen, es funktioniert auch wunderbar in Korea, wenn man das so darstellt, einfach um zu zeigen, okay, wir haben da was Verbindendes. Und das ist weltweit und das ist jetzt kein spezielles Energiegesetz hier und da oder es gibt einen zentralen Energieversorger oder wir haben hier ein dezentrales System wie in Deutschland. Das sind alles so Fragen.
Aber bei dem Thema Widerstand und gesellschaftliche Akzeptanz für das Großprojekt Energiewende, da sind wir alle gleich, da ticken wir alle gleich und jede Regierung der Welt, wenn sie denn mit der Energiewende konfrontiert wird und das ein Thema ist, muss diese Frage klären. Wie gehen wir mit dem Widerstand um, der dann eben überall stattfindet? Und da sehen Sie eben, ja harmlos, zwei Windräder in meiner Thüringer Heimat und überall kommt eben das NIMBY-Problem oder «not in my backyard». «Also ich finde ja Energiewende ganz gut, aber bitte die Windräder nicht bei mir in Sichtweite.» Das ist das Widerstandsproblem, was wir haben in den Köpfen der Leute. Und das ist das Widerstandsthema. Und wie lösen wir das Widerstandsthema? Das wird jetzt wenig überraschend sein für Sie hier im Raum, aber man muss es immer wieder betonen.

Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens auf, machen die Rollläden hoch, schauen aus dem Fenster und sehen da die Windräder in Blickrichtung in ihr schönes Heimatdorf oder Heimatstädtchen. Das können Sie gut finden, das können Sie schlecht finden. Meistens ist es so, wenn das ein Windprojekt eines externen Investors ist, gucken Sie eher so drauf: «Hm, na ja.» Der Blick ändert sich aber fundamental, wenn wir annehmen würden, ach, das sind die Windräder meiner Genossenschaft. Das gleiche Bild, ja, aber mit einer ganz unterschiedlichen Wirkung. Es kribbelt so leicht im Bauch, wenn man das sieht. Und es klingt so einfach, wir müssen uns hier auch nicht gemeinsam katholisch machen, wie wichtig die Bürgerbeteiligung ist und der Erzählstrang, der da drin steckt.
Ich habe jetzt letztens eine Diskussion verfolgt und da kam plötzlich die Aussage, die Bürgerenergie ist ja wichtig für die, sagt man das so, militärische Resilienz oder für unsere militärische Kraft, weil wir haben ja hier das dezentrale Energiesystem, da arbeiten wir ja mit dran. Und dezentral ist ja viel besser als zentral. Das ist nicht unsere Story. Unsere Story ist wirklich, Widerstände in den Köpfen abzubauen, zu gestalten und etwas aktiv zu machen. Und davon sollten wir auch wirklich nicht abweichen. Deswegen, Energiegenossenschaften, klar, die schaffen Eigentum, die schaffen Mitmachmöglichkeiten, die binden eben möglichst viele Menschen ein. Deswegen ist die finanzielle Beteiligung so wichtig, dass sie eben möglichst niedrig angelegt ist. Es wird die lokale Wertschöpfung gefördert.
Das werden Sie auch kennen. Man guckt, dass die Betriebe vor Ort davon was haben, vielleicht die Volksbank Raiffeisenbank damit involviert ist. Im positiven Fall, im idealen Fall. Und sie setzt auf den Erfolg der Gemeinschaft. Und es ist diese wahnsinnige Geschichte, die ich ja nun mehrfach gehört habe von den EWS: Wie kommt man eigentlich aus so einer Bürgerinitiative zum Betrieb eines Stromnetzes? Das ist ja eine unmögliche Geschichte. Das ist eben, weil man in der Gemeinschaft Erfolg erreichen kann. Es entsteht Freude, es wächst das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Man kann etwas verändern in seiner Gegend und es werden eben Widerstände abgebaut. Und damit möchte ich jetzt an der Stelle eigentlich den Schlusssatz sagen. Das Rebellentum hier trägt auch wirklich sehr gut dazu bei, diese Widerstände im Kopf zu lösen.
«Wie kommt man aus so einer Bürgerinitiative zum Betrieb eines Stromnetzes? Weil man in der Gemeinschaft Erfolg erreichen kann!»
Und ich ende mit der allerletzten persönlichen Story und dann bin ich auch mit meinen 30 Minuten durch. Sie sehen dort jetzt keine jubelnde Menschenmenge, das ist ein Unterschied zu dem, was Sie gerade bei dem Rückblick zur EWS gesehen haben, sondern Sie sehen da eine Wärmepumpe und ich habe mir die gestern Abend noch zuschicken lassen, das ist nämlich die neu installierte Wärmepumpe am Haus meiner Eltern. Die sind beide 79 Jahre alt und sind auf die Idee gekommen, eine Solaranlage aufs Dach zu legen, eine Wärmepumpe hinzustellen und einen Speicher in den Keller zu stellen.
Und ich würde sagen, 15 Jahre habe ich mit meinem Vater, wenn ich denn zu Besuch war, am Sonntagmorgen beim Frühstück diskutiert, ist das gut mit der Einspeisevergütung oder nicht. Und ich habe mehrheitlich eher kritische Fragen da beantworten müssen. Ja, man kann doch nicht mit der Schrotflinte so vorgehen und so weiter, all die Argumente, die es gibt. Und ich habe ihm gesagt, na ja, man kann das jetzt mit so einem Gesetz machen oder wir warten auf die nächste militärische Krise, die vielleicht kommen wird. Und siehe da, was passiert: Im zarten Alter von 79 Jahren ist die Investition in diese Anlage erfolgt.
Und was passiert jetzt? Jetzt sitze ich sonntags am Frühstückstisch bei meinen Eltern, meine Mutter am Tablet, mein Vater am Laptop. Und Sie schauen, wie der Zustand des Speichers ist und wie die Sonneneinstrahlung gerade ist. Das ist jetzt keine Genossenschaft, schade, aber es zeigt es, wenn da Eigentum besteht, wenn man selber mitmachen kann, selber einsteigt, entsteht einfach eine Freude und es ist eigentlich vollkommen wurscht, ob die Waschmaschine dann nun wirklich systemdienlich da eingestellt wird oder nicht für diesen Einzelhaushalt, aber es wird gemacht.
Also deswegen, das ist unsere gemeinsame Botschaft, die wir alle miteinander im Herzen tragen und alle auch wirklich insbesondere gegenüber der Politik immer wieder artikulieren müssen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu Ihrem Jubiläum. Vielen Dank für die langjährige Zusammenarbeit mit uns beim DGRV und ich wünsche natürlich viele weitere erfolgreiche Jahre den EWS. Herzlichen Dank.
Fotos: Bernd Schumacher



