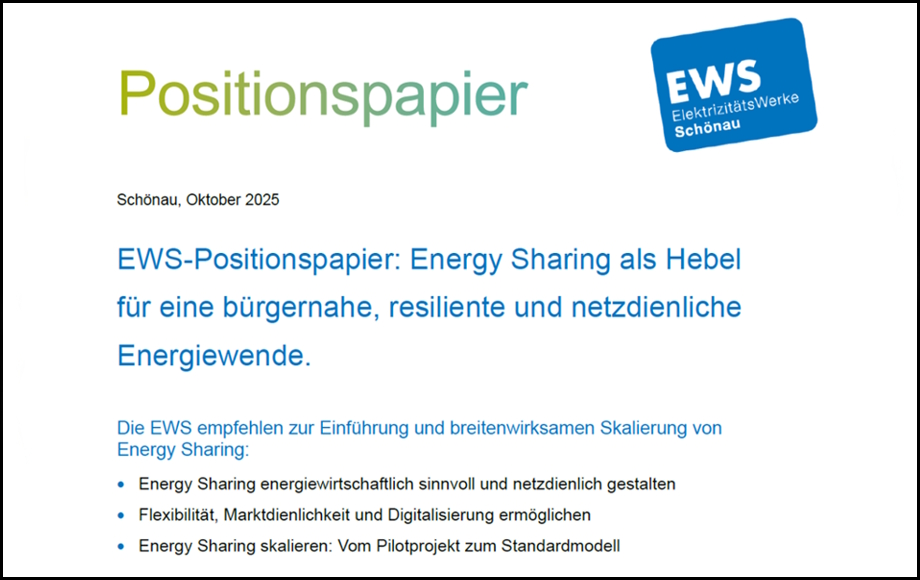Vor über 30 Jahren haben wir in Schönau gezeigt, dass Bürger:innen ihre Energieversorgung selbst in die Hand nehmen können. Energy Sharing ist der nächste logische Schritt auf diesem Weg. Es ist die Idee, dass der Strom vom Solardach des Nachbarn oder vom Bürgerwindrad im Ort direkt in der Nachbarschaft verbraucht wird – zu fairen Konditionen. Es ist die konsequente Fortsetzung der Energiewende von unten, für die wir seit unserer Gründung kämpfen. Sie macht Bürger:innen zu aktiven Mitgestalter:innen, erhöht die Akzeptanz für neue Anlagen und stärkt die lokale Wertschöpfung.
Die Bundesregierung hat mit einem Vorschlag für den § 42c im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) einen längst überfälligen Schritt getan, den wir ausdrücklich begrüßen. Doch der aktuelle Entwurf bleibt weit hinter den Möglichkeiten zurück. Der Gesetzgeber gesteht in der Begründung sogar selbst ein, dass mit dem Vorschlag keine massentaugliche Anwendung erwartet wird. Damit Energy Sharing nicht in der Nische verharrt, sondern seine volle Kraft für die Energiewende entfalten kann, haben wir in einem Positionspapier konkrete und praxistaugliche Verbesserungen formuliert.
Energy Sharing sinnvoll und netzdienlich gestalten
Ein funktionierendes Energy-Sharing-Modell sollte die Netze intelligent nutzen und für alle Beteiligten einfach umsetzbar sein. Ein zentraler Hebel dafür ist, netzdienliches Verhalten direkt zu belohnen. Wer Strom dann verbraucht, wenn er lokal reichlich vorhanden ist, entlastet das Netz. Dieser positive Effekt muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen, zum Beispiel durch die breitere Einführung zeitvariabler Netzentgelte. Je näher Erzeugung und Verbrauch beieinanderliegen, desto größer kann der Nutzen für das Netz sein. Deshalb sollte die gemeinschaftliche Stromnutzung in einem engen Radius, beispielsweise innerhalb von 4,5 Kilometern, gezielt durch eine Stromsteuerbefreiung angereizt werden.
Aus unserer eigenen Gründungsgeschichte wissen wir: Komplexe und unklare Regeln sind oft das größte Hindernis für bürgerschaftliches Engagement. Der aktuelle Entwurf droht mit seinen unklaren Prozessen genau diese Hürden wieder aufzubauen. Deshalb fordern wir klare und einfache Strukturen: Jede Gemeinschaft muss die Möglichkeit haben, einen zentralen Lieferanten für ihren restlichen Strombedarf zu wählen. Das schafft klare Verantwortlichkeiten und vereinfacht die Prozesse für alle Beteiligten, von der Bilanzierung bis zur Abrechnung. Um schnell aus der Praxis zu lernen und weitere Hürden abzubauen, sollten zudem über das Reallaborgesetz zügig weitere Pilotprojekte mit unterschiedlichen Konzepten des Energy Sharings auf den Weg gebracht werden.
«Energy Sharing ist mehr als ein Nice-to-have-Beteiligungsmodell: bei kluger Ausgestaltung kann es das Stromnetz entlasten und langfristig einen Beitrag zur Systemkostensenkung leisten.»
Konkrete Vorteile für Stromnetz und Systemkosten
Zudem entsteht ein positiver Effekt auf Netz und Kosten, weil lokal erzeugter und geteilter Strom die übergeordneten Netzebenen deutlich weniger belastet. Wenn Strom dort verbraucht wird, wo er erzeugt wird, müssen weniger Leitungen, Transformatoren und andere teure Netzinfrastrukturen ausgebaut werden. Lokal genutzter Strom reduziert die Notwendigkeit von Netzausbaumaßnahmen, wie Studien der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) einordnen. Eine breite Anwendung solcher Modelle kann so zu einer Reduktion der gesamten Stromsystemkosten führen.
Darüber hinaus wird der in Energy-Sharing-Projekten genutzte Strom nicht über das EEG gefördert. Diese Einsparungen kommen letztlich allen Steuerzahler:innen zugute, da die EEG-Umlage mittlerweile aus dem Staatshaushalt finanziert wird. Energy Sharing ist somit ein direkter Beitrag zu einem effizienteren und kostengünstigeren Energiesystem für alle – und macht die Energiewende nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch attraktiver.

Flexibilität, Digitalisierung und Markt ermöglichen
Moderne Energiegemeinschaften können weit mehr als nur Strom teilen. Sie können das Energiesystem aktiv stabilisieren, wenn die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Dafür ist es entscheidend, dass nicht nur direkte Lieferungen von Person A zu Person B erlaubt sind. Vielmehr muss auch das «Pooling» ermöglicht werden, bei dem der gesamte Strom der Gemeinschaft in einen gemeinsamen Topf fließt, aus dem sich alle bedienen. Dieses Modell ist deutlich effizienter und maximiert den gemeinsam genutzten Strom. In den Energiegemeinschaften schlummert ein wahrer Schatz an Flexibilität – etwa durch die intelligente Steuerung von E-Auto-Ladevorgängen, Wärmepumpen oder Batteriespeichern. Um diesen Schatz zu heben, muss der Gesetzgeber dringend Rechtssicherheit schaffen, damit Energiegemeinschaften diese Flexibilität bündeln und zur Netzstabilisierung vermarkten können. Das digitale Rückgrat dafür sind intelligente Messsysteme (iMS). Deshalb müssen Teilnehmende an Energy-Sharing-Projekten beim Rollout dieser Technologien priorisiert werden, um ihr Potenzial frühzeitig für das Gesamtsystem nutzbar zu machen.
Vom Pilotprojekt zum Standardmodell skalieren
Eine echte Bürgerenergiewende ist immer auch eine soziale Energiewende. Ein Modell ist nur dann erfolgreich, wenn alle mitmachen können – unabhängig vom Geldbeutel. Gerade für einkommensschwächere Haushalte und Mieter:innen ohne eigenes Dach kann Energy Sharing den Zugang zu günstigem, lokalem Ökostrom ermöglichen und so für mehr Preissicherheit sorgen. Dafür braucht es aber spürbare finanzielle Vorteile. Wir fordern deshalb unter anderem reduzierte Netzentgelte, die Befreiung von der Stromsteuer und eine geringere Belastung durch Umlagen wie die Konzessionsabgabe. Um die Attraktivität für Prosumer zu sichern, muss Energy Sharing dem Eigenverbrauch gleichgestellt werden. Außerdem muss § 14a EnWG so geöffnet werden, dass auch gemeinschaftlich betriebene Anlagen wie Batteriespeicher oder Ladeinfrastruktur von vergünstigten Netzentgelten profitieren können.
Gleichzeitig gilt es, praxisfremde Regeln und Bürokratiemonster zu verhindern. Die aktuelle Begrenzung auf nur eine Erzeugungsanlage pro Gemeinschaft ist realitätsfern. Gleichzeitig muss die Schwelle, ab der umfangreiche und teure Lieferantenpflichten greifen, auf praxistaugliche 2 Megawatt (MW) angehoben werden, um eine praxisnahe Umsetzung und Wirtschaftlichkeit zu ermöglichen. Zudem brauchen Kommunen und lokale Initiativen Unterstützung. Nach dem Vorbild Österreichs fordern wir eine bundesweite Beratungsinfrastruktur in Deutschland, die Kommunen, Initiativen und Energiegenossenschaften dabei hilft, Projekte vor Ort effizient umzusetzen und dauerhaft tragfähig zu betreiben.
Fazit: Eine Chance, die wir jetzt ergreifen müssen
Der Kampf für eine bürgernahe Energiewende wird nicht allein in den Ministerien gewonnen, sondern vor Ort – so wie damals in Schönau. Der aktuelle Gesetzesentwurf ist ein Anfang, aber er muss deutlich mutiger werden. Es liegt nun an der Politik, die Weichen so zu stellen, dass bürokratische Hürden fallen und die Vorteile direkt bei den Menschen ankommen. Machen wir Energy Sharing zu dem, was es sein sollte: die Energie-Rebellion für alle.
Titelbild: Adobe Stock (Asset-ID-Nr.: 314835218)