Unser diesjähriges «Schönauer Stromseminar» fand unter dem Motto «Die Zukunft liebt Rebell:innen» ganz im Zeichen von gleich zwei Jubiläen statt – 30 Jahre EWS und 15 Jahre Genossenschaft. Das nahm Thomas Jorberg, Schönauer Stromrebell 2002 und Aufsichtsratsvorsitzender der EWS, zum Anlass, einen Blick in die Zukunft der EWS zu wagen. Darin resümierte er, dass es eine assoziative genossenschaftliche Energiekooperation braucht, um rein regenerativ, sicher versorgt, preisgünstig im Wettbewerb, sozial im Ausgleich sowie friedensstiftend und ganzheitlich zu sein: «Und nur wer das Unmögliche versucht, wird das Mögliche erreichen.» Die Rede stellen wir Ihnen etwas weiter unten zur Verfügung.
Zur Person Thomas Jorberg

Thomas Jorberg, Jahrgang 1957, war von 2003 bis 2023 Vorstandssprecher der GLS Bank mit Sitz in Bochum. Seine berufliche Laufbahn begann er dort als erster Auszubildender im Jahre 1977. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften kehrte er 1986 dorthin zurück. Ein Schwerpunkt seiner Vorstandstätigkeit lag in der strategischen Weiterentwicklung der GLS Bank als konsequent sozial-ökologisches Geldinstitut. In den 1990er Jahren war er als GLS-Vorstandsmitglied wesentlich daran beteiligt, die Stromrebell:innen aus dem Schwarzwald beim Netzkauf zu unterstützen.
Jorberg ist Mitgründer und Kuratoriumsmitglied der Stiftung Neue Energie und gehörte 2009 zu den Initiatoren von ruhrmobil-E, einem Verein zur Förderung von Elektromobilität. Seit 2005 ist Jorberg Aufsichtsratsvorsitzender der EWS Elektrizitätswerke Schönau eG.
Zum Portrait im Energiewende-Magazin
Video der Rede von Thomas Jorberg vom 28. Juni 2025
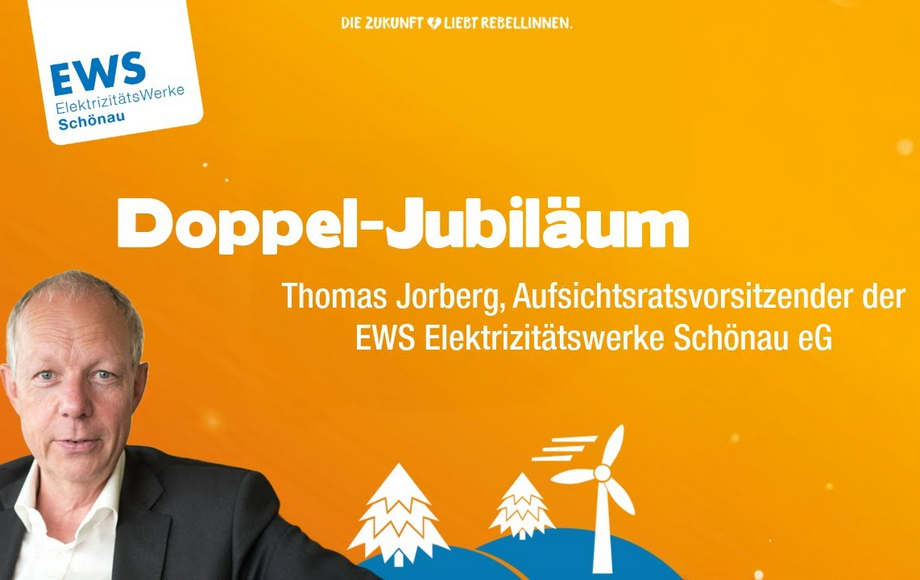
Ja, ich möchte Inhalte von YouTube angezeigt bekommen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Rede von Thomas Jorberg im Wortlaut
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es ist ein toller Vormittag gewesen, das alles nochmal mitzuerleben, was hier für ein Mut, was für eine Freude, was für eine Begeisterung und was für eine Rebellion da war und auch welchen Erfolg die EWS nicht nur als Unternehmen haben, sondern weltweit, kann man ja sagen. Ich weiß nicht, ob der heutige Präsident der USA noch Ursula Sladek einladen würde. Aber da hat sich eher die Präsidentschaft geändert. Aber ein Riesenerfolg, den wir haben. Und ohne diese Entwicklung wäre die Entwicklung der regenerativen Energien so nicht möglich gewesen. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, ohne unbescheiden zu sein.
Also ohne die Schönauer wäre das nicht möglich gewesen. Und auch ohne viele, viele andere Energiegenossenschaften – Herr Wieg hat es ja schon erwähnt, in welcher Geschwindigkeit neue Energiegenossenschaften sich entwickelt haben –, ohne das Bürgerengagement hätte es diese Entwicklung nicht gegeben. Und heute können wir sagen, Simone Peter hat es schon gesagt, die Entwicklung regenerativer Energien ist unumkehrbar – auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn man um 12 Uhr eine Rede hält im Juni, dann hat die Sonne in doppeltem Sinne den höchsten Stand. Und das soll man auch genießen, daran soll man sich freuen. Das ist wunderbar. Trotzdem kommt der Nachmittag, kommt der Abend, kommt die Nacht und es kommt ein neuer Morgen.
Und insofern will ich jetzt, obwohl ich stundenlang Geschichten auch noch erzählen könnte, und das hat wirklich mein Leben geprägt, diese Beziehung, diese Leidenschaft mit und in Schönau, ein bisschen den Blick auf heute und auf morgen richten. Und man kann ja die Frage haben, so als Rebell, wenn man jetzt von überall her Rückenwind kriegt und von überall her Anerkennung bekommt und sich freuen kann, dass man das System teilweise verändert hat, aber schon auch ein bisschen Teil des Systems geworden ist, dieses veränderten Systems, wie ist es dann eigentlich mit dem Rebellentum noch?
Und es gehören übrigens zwei Seiten, wie in einer Liebesbeziehung immer, dazu. Es ist nicht nur sozusagen, die Zukunft liebt den Rebellen, sondern der Rebell muss auch die Zukunft lieben. Und die Vergangenheit auch. Und ich zitiere nochmal Sie, Simone Peter, wir haben unglaublich viel Rückenwind in den letzten Jahren für regenerative Energien bekommen. Aber was ist denn eine Windkraftanlage, was macht die, wenn die Rückenwind kriegt? Dann dreht sie sich um, weil sie den Gegenwind braucht. Ohne Gegenwind keine Energie aus der Windenergie. Und ich habe den Eindruck, an der Situation stehen wir auch so ein bisschen, dass wir sagen müssen, okay, der Wind hat sich offensichtlich gedreht, der kommt jetzt von hinten und insofern müssen wir uns umdrehen, um die Energie wiederzugewinnen.
«Was macht eine Windkraftanlage, die Rückenwind kriegt? Sie dreht sich um, weil sie den Gegenwind braucht.»
Und ja, vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu machen, auch noch so die Analyse vielleicht der gesamten Nachhaltigkeitsbewegung, die ja entstanden ist, wie die Geschichte, die wir auch heute gehört haben, also ob das jetzt im ökologischen Bereich, die Friedensbewegung war in den 1980er, 1990er Jahren, auch schon früher, das ist die Bewegung gegen bestehende Systeme, gegen das Establishment, um das aufzubrechen, um Dinge möglich zu machen, die eben eine lebenswerte Zukunft brauchen. Im ökologischen Sinne, wie auch im Friedenssinne, wie auch im sozialen Bereich.
Darauf hat sich ja eine gesamte Nachhaltigkeitswirtschaft entwickelt. Und ich hatte das Glück, sehr, sehr viel davon wahrzunehmen in der GLS Bank – und Unglaubliches erreicht, auch im Energiebereich insbesondere, aber auch in der Ernährungswirtschaft, bei den Lebensmitteln, im Bankenbereich, im Kosmetikbereich, mit dem ich mich im Moment auch intensiv beschäftigen darf, im Verkehr anfänglich. Also eine unglaubliche Entwicklung, die wir gemacht haben. Und wir wissen alle, technisch gibt es eigentlich keine Probleme. Das ist auch die Dynamik, die die Entwicklungsgeschwindigkeit der letzten 30 Jahre nimmt. Dann kann man eigentlich nur sehr, sehr positiv in die Zukunft schauen. Wir sehen eins, an der Technik wird es nicht scheitern. Woran dann?
Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch «Unhaltbarkeit» von Ingolfur Blühdorn gelesen hat. Der spielt ein bisschen mit dem Begriff nachhaltig und nicht nachhaltig, deswegen unhaltbar. Und er nennt das die ökosoziale Bewegung oder die ökoemanzipatorische Bewegung, die so entstanden ist, wie ich das geschildert habe. Seine Analyse ist, diese Bewegung ist heute selber durch ihren Erfolg zum Establishment geworden. Und wir haben es nicht geschafft, so Blühdorn – das ist nicht ganz meine Auffassung, aber es ist interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen –, wirklich die Breite der Bevölkerung mit mittleren und niedrigen Einkommen davon zu überzeugen, dass das die eigentliche Zukunft ist. Insofern gibt es viele Rahmenbedingungen, die die Politik eigentlich ändern müsste und es bleibt dabei, ohne dass CO₂-Emissionen so teuer sind, dass es sich mehr lohnt, CO₂ einzusparen, werden wir im Endeffekt nicht die Wende wirklich vollziehen können.
Und es braucht einen sozialen Ausgleich für diejenigen, die sich das nicht leisten können in Form von Energiegeld und wie auch immer. Und diese ganz elementare Weichenstellung ist nicht getroffen worden in der ausreichenden Form heute. Sie ist wie vom Tisch gefegt von der politischen Diskussion. Und insofern ist da schon was Wahres dran, wenn man sagt, das ist offensichtlich nicht das Zukunftsbild, was in der Breite der Bevölkerung da ist oder zumindest kann die Politik das nicht vermitteln als ein Zukunftsbild. Und insofern, so Blühdorn, ob das nun die Bio-Lebensmittel oder die Energie oder alle möglichen anderen nachhaltigen Produkte sind, ist das Gefühl – zum Teil zu Recht, zum Teil nicht zu Recht – da, das ist eigentlich zu teuer für uns, das ist mehr was für das wohlhabende Bildungsbürgertum.
In einer nüchternen Analyse, die man, glaube ich, heute machen muss, kann man sich, ich will es mal so formulieren, dieser These nicht ganz verschließen. Denn wir sind dort angekommen in diesem System und wir sind Teil des Systems und wir sind auch ein Teil des Establishments. Und insofern stellt sich die Frage, wenn wir ein Teil geworden sind, wie werden wir denn wieder zu Rebellen? Also wenn ich das selber bin, ja wie werde ich denn dann wieder zum Rebell um Himmels willen? Weil es ist ja schön, wenn man Rückenwind hat, das ist doch wunderbar. Und es ist doch toll, was wir alles geschafft haben, das meine ich ganz ernst. Und trotzdem ist die Frage, da bin ich gar nicht drauf gekommen, weil es ist echt ein gutes Bild zu sagen, also die Windenergie, die dreht sich halt dann wieder in den Gegenwind: Ja, wie drehen wir uns denn dann wieder rein?
Das kann nur in uns selber erstmal stattfinden. Dass wir uns selber kritisch hinterfragen, was hat denn dazu geführt, dass es nicht mehrheitsfähig geworden ist. Obwohl das absolut richtig ist. Ich glaube, da ist keiner hier im Saal, der das in Zweifel zieht. Und da spielt sicherlich der Preis eine große Rolle dabei. Und auch, dass es nicht wirklich vermittelbar ist, dass es eigentlich technisch gar keine Probleme gibt. Es gibt riesige Probleme technisch. Das will ich da gar nicht sagen, dass es nicht technische Probleme gibt. Es gibt riesengroße technische Probleme, aber kein einziges, was nicht lösbar ist. Und das haben wir nicht vermittelt gekriegt. Und auch nicht, dass es wesentlich billiger gesamt volkswirtschaftlich ist ohne regenerative Energien.

Und die Internalisierung externer Effekte, die der einzige Weg ist, kommt beim Durchschnittsbürger so an, dass alles teurer wird. Also mache ich es lieber nicht. Und insofern glaube ich, und vielleicht noch ein Blick jetzt auf die regenerativen Energien, auch ein bisschen ein kritischer Blick, wir haben eine unglaubliche Segmentierung im Bereich regenerativer Energien. Das haben wir in anderen Bereichen auch, aber eben auch im Bereich regenerativer Energien. Auch ein Beispiel an der Windenergie. Das fängt an mit dem Grundstückseigentümer. Der hat halt unglaubliche Preisvorstellungen, wie hoch sein Anteil sein soll an dem Erlös der Windkraftanlage, die er als Grundstückseigentümer kriegt, obwohl das ja irgendwie in Bezug auf die Gesamtfläche ziemlich überschaubar ist.
Allen voran die öffentliche Hand. Also das muss man sagen, die Finanzminister, auch die Grünen, sagen ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Einnahmen geworden, da kann ich gar nicht drauf verzichten. Das landet aber alles im Strompreis, denn wer soll es bezahlen? Und dann von dieser Kette geht es los, dann kommt der Projektentwickler, dann kommt der Umsetzer, dann kommt der Investor, dann kommt der Direktvertrieb und alle möglichen anderen Stufen da drauf, sehr stark segmentiert. Jeder will seinen Gewinn daran machen, da ist auch im Prinzip nichts dagegen zu sagen. Aber das geht alles in den Strompreis rein.
«Die ökosoziale Bewegung ist durch ihren Erfolg selber zum Establishment geworden. Und wir haben es nicht geschafft, die Breite der Bevölkerung mit mittleren und niedrigen Einkommen davon zu überzeugen, dass das die eigentliche Zukunft ist.»
Die Einsparung des technischen Fortschritts ist nicht zu 100 Prozent beim Stromkunden angekommen. Das ist das eine Problem, was ich sehe. Und das andere eben auch, dass tatsächlich die Stromproduktion nicht unmittelbar beim Stromkunden ankommt, auch in einer Genossenschaft nicht. Wenn man sich das genau anguckt, ist das in unterschiedlichen Gesellschaften also sehr, sehr komplex gemacht. Und auch – also es ist alles Selbstkritik, weil ich komme aus dem genossenschaftlichen Bereich, ich war da mit drin und bin auch noch überzeugt davon – die unglaubliche Anzahl von Genossenschaften ist in sich und regional eine ganz tolle Sache und Voraussetzung für diese Entwicklung gewesen, aber sie sind in sich und oft nicht zur wirklichen Zusammenarbeit fähig. Das gehört auch zur Geschichte dazu und das trifft auch auf die größeren Energiegenossenschaften zu, wie uns selber, die EWS oder GPE oder Prokon oder die Bürgerwerke und andere mehr.
Im Wettbewerb ist man eigentlich eher Konkurrent als wirklich enger Kooperationspartner. Und gleichzeitig, durch diese Segmentierung, aber auch durch die Reglementierung und dadurch, dass wir heute Speicher brauchen, dadurch, dass wir in der Wärme da drin sind, dadurch, dass wir Smart Metering brauchen, dass wir Steuerung brauchen, dass wir alle möglichen Leistungen auseinanderhalten müssen und eine Flutwelle von Regulatorik zu bewältigen ist, ist nach meiner Einschätzung das nicht in diesen kleinen Einheiten wirklich zu leisten. Und insofern, glaube ich, und das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, das ist nicht die in meiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender, brauchen wir eine viel, viel engere Kooperation von Energiegenossenschaften. Aus folgenden, ja auch eigentlich sehr offensichtlichen Gründen.
Zum einen betriebswirtschaftlich, weil die Investitionen in die Entwicklung sind so teuer, dass sie sich eigentlich gar nicht jeder einzeln leisten kann. Oder er muss sie von außen einkaufen. Aber dann haben wir immer noch diese Segmentierung, die das Ganze teurer macht. Und dann haben wir eben auch, wir sind komplett eingebunden in das Marktsystem. Also das Rauf und Runter an den Strombörsen schlägt, insofern es nicht langfristige Verträge gibt, immer unmittelbar durch, auch auf die Energiegenossenschaften. Ob sie nun nur Strom produzieren oder ob sie Strom verkaufen, jeweils ist immer der Markt dazwischen. Und insofern ist es auch eine Systemfrage. Und ich würde sagen, man braucht ein offen geschlossenes System von Genossenschaften, in dem man wirklich zeigen kann: regenerative Energien, die könnte man 100 Prozent in die Versorgung integrieren, und zwar direkt und nicht immer indirekt und stark beeinflusst durch das Marktgeschehen. Ohne Einfluss geht es nicht, aber nicht immer so direkt beeinflusst.
Das ist die Herausforderung, die ich meine. Und zum anderen, dass es eine sichere und stetige Stromversorgung nur mit regenerativen Energien gibt. Das ist eine große Herausforderung, aber sie ist möglich, wie wir alle wissen. Aber nicht in so kleinen Einheiten, wie wir sie heute haben, sondern da bräuchte es einen Zusammenschluss zumindest der größeren Energiegenossenschaften, zu zeigen, es geht eine sichere und stetige Stromversorgung nur mit regenerativen Energien. Dazu sind einige Investitionen auch in die Speicherung notwendig, die man auch nur gemeinsam stemmen kann.

In der Vergangenheit war ich auch immer der Auffassung, wenn man qualitativ sehr, sehr viel besser ist als andere, dann darf es auch teurer sein. Das ist auch richtig gewesen für diese Entwicklung. Ohne das wäre es in all den Nachhaltigkeitsbereichen kaum möglich gewesen. Aber das ist ein Hemmschuh am Markt und es ist eine Zugangsschwelle für sehr, sehr viele Teile der Bevölkerung. Und insofern, glaube ich, ist es notwendig, dass wir zu marktkonformen Konditionen oder möglichst etwas unter dem Markt auch diesen Strom in der Breite anbieten können. Wenn man ein solches, ich nenne es mal – es ist widersprüchlich, ich weiß, aber so ist die Welt – geschlossenes, offenes System macht, das gilt technisch im Strom, aber auch sozial, dann kann man zeigen, dass das auch sozial ist, dass es direkt ist, dass es wirklich in Bürgerhand ist und nicht nur ein Teil in Bürgerhand ist. Und auch das: In der heutigen Zeit ist es notwendig, dass man zeigt, ein solches geschlossenes, offenes System ist notwendig und zeigt, das ist ein friedensstiftendes System.
Weil fast alle Kriege hängen letztendlich mit Rohstoff- und Energiefragen zusammen. Und insofern ist zu zeigen, dass in einem größeren Umfang in einem Land wie Deutschland das möglich ist, es ein Friedensbeitrag ist, den wir leisten können. Und es muss natürlich ganzheitlich sein. Da vielleicht noch mal zu der Frage Genossenschaften. Wir hatten es gestern auch schon in der Generalversammlung, sind wir eigentlich eine Verbrauchergenossenschaft? Nein. Oder auch. Aber uns selber immer auseinanderzudividieren, als Bürger, als Verbraucher, als was weiß ich, was alles, ist ja gerade der Kern des Problems. Also wenn wir uns selber anfangen zu segmentieren, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Welt so ist, sondern dass wir einen ganzheitlichen Blick darauf haben und eben ökologische Fragen, soziale Fragen, Friedensfragen gemeinsam im Blick haben.
Und das ist der Förderauftrag, den im Grunde genommen alle diese kleineren und größeren Energiegenossenschaften auch haben. Und sich zusammenzutun und zu sagen, den erbringen wir gemeinsam in Zukunft für unsere Mitglieder, da sehe ich eine große Chance, aber auch viele, viele Widerstände. Dafür braucht es das Rebellentum. Dafür müssen wir den Gegenwind genießen. Denn ich gehe schon eine ganze Weile damit um und konnte auch bei Prokon vor den Mitgliedern diesen Impuls geben. Und wir sind es ja gewohnt, gegen Widerstände zu gehen. Und natürlich höre ich auch ganz viel, das geht nicht, das in der Regulierung geht nicht, deswegen geht es nicht und so weiter.
Also sehr, sehr viele Widerstände sind in uns selber, aber auch in dem System, in dem wir im Moment sind. Und da müssen wir uns wieder aufmachen, sozusagen diese Komfortzone zu verlassen, die eigentlich sehr ungemütlich ist, aber halt doch da ist und sagen, na ja, wenn einer sagt, es geht nicht, dann fängt der Spaß erst an, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, muss man trotzdem immer noch überprüfen. Aber wenn wir nicht über das Erste und das Zweite «geht nicht» hinauskommen, dann werden wir nicht diese Wende in der Energiewende machen können. Also das ist notwendig, dass wir diesen Widerständen auch in uns selbst nochmal angehen.
«Was wir brauchen, ist eine assoziative genossenschaftliche Energiekooperation, um diese Energieversorgung zu schaffen: rein regenerativ, sichere Versorgung, preisgünstig im Wettbewerb, sozial im Ausgleich, friedensstiftend und ganzheitlich.»
Und das war nicht mein Titel übrigens: Impulsvortrag. Der hat mir nur jede Freiheit gegeben. Also das muss man ja auch dazu sagen. Ich kann ja nur meinen Impuls geben, ob das bei Ihnen zum Impuls führt, das liegt ja völlig bei Ihnen. Aber ich meine, was wir brauchen, ist eine assoziative genossenschaftliche Energiekooperation, um eben das zu schaffen: rein regenerativ, sichere Versorgung, preisgünstig im Wettbewerb, sozial im Ausgleich und friedensstiftend und ganzheitlich zu sein. Dafür brauchen wir das. Und nur wer das Unmögliche versucht, wird das Mögliche erreichen. Vielen Dank.
Fotos: Albert Josef Schmidt, Bernd Schumacher



