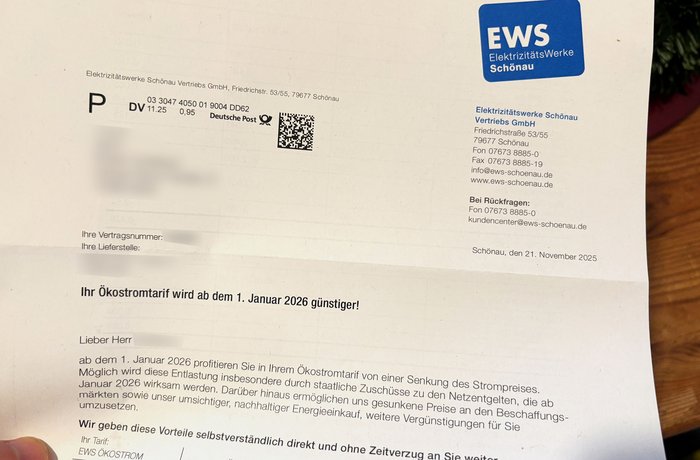Als am letzten Septemberwochenende der neue EWS-Solarpark am Rande des Schwarzwaldorts Döggingen eingeweiht wird, begrüßen sich Bürgermeister, Gemeindevertreter, Mitarbeiter der Baufirmen und die Verantwortlichen der EWS wie alte Bekannte. Kein Wunder – war die Runde doch nicht nur zum Baubeginn vor einem halben Jahr, sondern auch bereits im Vorjahr zur Eröffnung des ersten EWS-Solarparks in dem zur Stadt Bräunlingen gehörenden Ort zusammengekommen. In Döggingen, so scheint es, geht die Energiewende schneller voran als anderswo.
EWS eröffnen Solarparks im Halbjahrestakt
Nach dem Ende 2016 fertiggestellten Solarpark Herten dauerte es zunächst acht Jahre, bis die EWS seit Frühjahr 2024 gleich drei neue PV-Freiflächenanlagen eröffnet haben, neben den beiden in Döggingen auch noch einen in der Gemeinde Fröhnd. Für den kleinen Boom, der in Mörzenbrunnen bei Villingen-Schwenningen sowie im niedersächsischen Lauenbrück schon sehr bald seine Fortsetzung finden wird, gibt es mehrere Ursachen. Ein entscheidender Grund liegt in der guten Kooperation mit den Gemeinden. Denn dass es in Bräunlingen – und speziell im Ortsteil Döggingen – nun schon zum zweiten Mal so reibungslos läuft mit Planung, Bau und Betrieb der Anlagen, hat viel zu tun mit den Vorbereitungen, die einige Jahre zurückreichen.
Im Jahr 2020 beschloss der Bräunlinger Gemeinderat eine Potentialplanung, mit der die Stadt das Umweltbüro Donaueschingen beauftragt hatte. Damit konnten frühzeitig Flächen ausgewiesen werden, die nicht zu nah an Siedlungen und Waldflächen sowie außerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten liegen und die auch nicht zu den besten landwirtschaftlichen Flächen gehören. Und nicht zuletzt stellt die Gemeinde die den Genehmigungen zugrundeliegenden Kriterien sehr transparent dar.

Artenschutz und Weidewirtschaft im Park
Die Flächen in Döggingen, auf denen der Solarpark nun betrieben wird, sind zudem zum größten Teil in kommunalem Eigentum. Wie in Fröhnd erzielt die Gemeinde dadurch auch gute Pachteinnahmen. Gerade für Kommunen ohne Industrie und großes Gewerbe sind solche fest planbaren finanziellen Mittel wichtig, um das soziale und kulturelle Leben auf dem Land aufrechterhalten zu können. Oder um andere Kosten für die Bevölkerung zu senken, wie in Fröhnd, wo die Gemeinde durch die Einnahmen aus dem Solarpark die Preise für die Wasserversorgung senken kann.
Neben Transparenz und guter Kooperation bei der Projektentwicklung sowie finanziellen Vorteilen für die Kommunen tragen auch die Erfahrungen im Betrieb von Solarparks zu deren wachsender Akzeptanz bei: Die Flächenkonkurrenz zwischen Ökostrom-Gewinnung und Landwirtschaft ist weniger gravierend, als anfangs befürchtet. Schafe beweiden die Flächen aller EWS-Solarparks, was für die lokalen Schäfer:innen den Vorteil mit sich bringt, dass die Tiere viel Nahrung und ausreichend Schatten unter den Solarpanelen finden. Die bereits vorhandene Umzäunung des Solarparks bietet zudem gute Voraussetzungen für weitere Herdenschutzmaßnahmen, beispielsweise vor Wölfen.
Und auch beim Arten- und Naturschutz sind erste Befürchtungen der Erkenntnis gewichen, dass Solarparks die Artenvielfalt gegenüber früheren Nutzungen noch verbessern. Dies zeigt eine vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne) im Frühjahr veröffentlichte Studie. Und auch in den EWS-Solarparks wird dies deutlich. Durch die Randbepflanzung mit heimischen Bäumen und Sträuchern sowie die Aussaat von Gräsern und Blütenpflanzen ist es schon jetzt gelungen, die Anlagen in die Natur- und Kulturlandschaft einzubetten. Sie bieten insbesondere Insekten und Vögeln gute Lebens- und Rückzugsräume. Und Steinhaufen locken – dies lässt sich im ersten EWS-Solarpark in Herten beobachten – Eidechsen und andere Reptilien an.

Infrastruktur und Rahmenbedingungen noch ausbaufähig
Eine Win-Win-Win-Situation also für Naturschutz, Landwirtschaft und Energiewende? Noch gilt es, eine Reihe von Schwierigkeiten zu meistern. Insbesondere die Rahmenbedingungen für die erheblichen Investitionen haben sich teils verschlechtert. Gegenüber der lang anhaltenden Niedrigzinsphase sind Kredite heute deutlich teurer. Zwar sind Solarmodule und Wechselrichter effizienter und günstiger geworden, auf der anderen Seite jedoch die Baukosten spürbar gestiegen. In Döggingen hat zudem die schlechte Netzinfrastruktur zu erheblichen Mehrkosten geführt. Weil die Leistung des Solarparks mit knapp 16 Megawatt sehr groß ist, musste der Netzanschlusspunkt ans Umspannwerk im benachbarten Löffingen gelegt werden. Dazu mussten die Netzanschlusskabel über eine Entfernung von sieben Kilometern verlegt werden – unter kleinen Flussläufen, durch Schluchten und Wälder. Mehr als zwei Millionen Euro kostete es schließlich, den Strom aus dem Solarpark ins Netz einzuspeisen.
Sicherheit braucht Netze
Auch sonst hängt der weitere Bau und Betrieb von Solarparks eng mit dem Um- und Ausbau der Stromnetze zusammen. Die Diskrepanz zwischen hoher Stromeinspeisung bei sonnigem (und windigem) Wetter und geringer Zufuhr bei Flaute führt zu erheblichem Aufwand bei der Aufrechterhaltung der Netzstabilität – und damit zu zusätzlichen Herausforderungen. Für die Betreiber:innen der Anlagen – auch für die EWS – bedeutet dies, dass der Strompreis in sonnigen Zeiten ins Negative fallen kann. Dann bringen die Solarparks keine Einnahmen oder werden sogar in der Leistung gedrosselt oder ganz abgeregelt. Doch auch hierfür wappnen sich die EWS bereits und prüfen den Bau von Batteriespeichern in den oder in der Nähe der Solarparks. Damit der Strom tagsüber produziert und bei Bedarf abends oder nachts genutzt werden kann.

Noch ist nicht absehbar, ob der Boom bei Solarparks andauern wird. Zu unsicher sind die politischen Rahmenbedingungen, die offenen Fragen bezüglich des Netzausbaus sowie der Zukunft des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und nachfolgender Regelungen. Zunächst geht es für die EWS jedoch weiter im Halbjahrestakt: Der Solarpark im niedersächsischen Lauenbrück wird bald fertiggestellt sein und dann ca. 8,8 Gigawattstunden (GWh) Sonnenstrom im Jahr produzieren. Und der Solarpark Mörzenbrunnen nahe Villingen-Schwenningen wird mit einer Stromproduktion von 7,5 GWh im Jahr voraussichtlich Anfang 2026 ans Netz gehen.