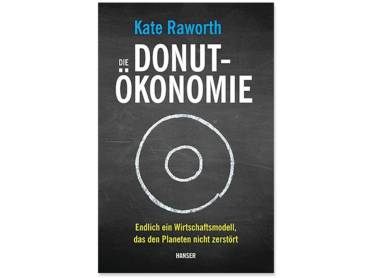«Kein System wächst endlos»
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth im Gespräch mit Maike Brzoska
Kate Raworth bricht mit der gängigen Wirtschaftslehre. Ihre «Donut-Ökonomie» vereint die Bedürfnisse der Menschen und die natürlichen Grenzen des Planeten.
Kate Raworth hat Großes vor: Sie will die Ökonomie von Grund auf neu denken. Dafür hat sie ein Modell entwickelt, das mit dem heutigen Wachstumsdogma bricht. Denn nur, wenn wir unser Wirtschaftssystem komplett umbauen, so die britische Wirtschaftswissenschaftlerin, können wir unseren Planeten dauerhaft zu einem sicheren und gerechten Ort für die Menschheit machen. Sie nennt ihr Modell «Donut» – wohl wissend, dass der Begriff erst einmal irritiert. Ihre Vision hat sie der Vollversammlung der Vereinten Nationen und der Wirtschaftselite in Davos vorgestellt.
Im Frühjahr 2018 ist sie mit ihrem Buch «Die Donut-Ökonomie» auf Lesetour in Deutschland. An einem dieser Tage sitzt sie in einer gemütlichen Lobby eines kleinen Hotels in Berlin-Mitte und gibt ein Interview nach dem anderen. Gut gelaunt ist sie trotzdem. Organisiert hat die Tour das «Netzwerk Plurale Ökonomik», eine von Studenten organisierte Bewegung, die sich für mehr Vielfalt in der Volkswirtschaftslehre einsetzt.

Frau Raworth, an wen richtet sich das Donut-Modell?
Ich sehe das Donut-Modell als Kompass für unseren künftigen Wohlstand. Es soll zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Vor allem für Ökonomen ist das wichtig. Denn deren Empfehlungen stellen die Weichen dafür, wohin sich eine Gesellschaft entwickelt. Ich würde mit VWL-Studenten im ersten Semester deshalb zuerst über den Donut diskutieren.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie das Modell entwickelt haben, weil Sie von Ihrem eigenen Ökonomie-Studium enttäuscht waren.
Ich war ein Teenager der 1980er-Jahre, bin also aufgewachsen mit einem Loch in der Ozonschicht und den ersten Berichten über den Treibhauseffekt. Meine Kindheit habe ich im Großbritannien von Margaret Thatcher verbracht. Das alles hat mich stark geprägt. Ich wollte über soziale Gerechtigkeit diskutieren und Lösungen für Umweltprobleme finden. Ich dachte, das Ökonomie-Studium würde mich mit dem nötigen Rüstzeug ausstatten. Deshalb habe ich mich eingeschrieben.
Aber gerade am Anfang ist das Ökonomie-Studium sehr theoretisch.
Es ging los mit unglaublich abstrakten Diagrammen, da hieß es: Es gibt eine Angebots- und eine Nachfragekurve, und wo diese sich treffen, ist der Markt im optimalen Zustand. Das ist ja bis heute der Kerngedanke der Ökonomie. Umweltprobleme kommen in diesen Modellen – wenn überhaupt – nur am Rande vor, als sogenannte externe Effekte. Was nichts anderes bedeutet, als dass man sie ausklammert.
Wir müssen die ökonomischen Modelle von Grund auf neu denken.
Was genau haben Sie vermisst?
Was mir in erster Linie gefehlt hat, war die Frage: Wozu das alles? Wir haben im Studium nie darüber gesprochen, was eigentlich das Ziel solcher Modelle ist. Darüber wollte ich diskutieren.
Ein Ökonom würde sagen, Sinn und Zweck seiner Fachrichtung ist, den Wohlstand eines Landes zu steigern.
Da sollten wir als zuerst fragen: Was bedeutet Wohlstand heute? Was brauchen wir wirklich, damit es uns gut geht? Die Standardantwort von Ökonomen ist immer noch, dass wir Wachstum brauchen. Wir produzieren immer mehr, um unser Bruttoinlandsprodukt weiter zu steigern. Diese Antwort stammt aus den letzten Jahrhunderten, sie passt nicht mehr in unsere Zeit. Wir brauchen neue Lösungen, und dafür müssen wir die ökonomischen Modelle von Grund auf neu denken. Denn solche Modelle prägen unser Denken.
Das Bruttoinlandsprodukt (kurz BIP)
ist die Kennzahl für die Wertschöpfung eines Landes. Man erhält es, indem man die Marktpreise aller produzierten Güter und Dienstleistungen addiert. Steigt das BIP, haben wir Wachstum, sinkt es, schrumpft die Volkswirtschaft. Eingeführt wurde die Kennzahl nach dem Zweiten Weltkrieg; seitdem ist sie weltweit die maßgebliche Größe für den Wohlstand eines Landes, an der sich Politiker wie Ökonomen orientieren.
Aber was ist so falsch am BIP-Wachstum?
Das BIP ist eine sehr einseitige Kennzahl. Sie ist zu oberflächlich, um unseren Wohlstand zu messen. Unentgeltliche Arbeit etwa, wie Pflege oder Erziehung, fließt nicht mal in die Kennzahl ein. Trotzdem setzen Ökonomen und auch Politiker immer noch auf Wachstum, weil sie glauben, dass es Menschen dadurch besser geht. Aber stattdessen spaltet unsere Art zu wachsen eine Gesellschaft eher, wie Thomas Piketty in seinem Buch «Das Kapital im 21. Jahrhundert» eindrucksvoll zeigt. Er hat nachgewiesen, dass vom BIP-Wachstum vor allem die Reichsten profitieren. Deshalb haben wir heute diese extreme Ungleichheit. Und gleichzeitig zerstören wir mit dieser Art des Wachstums unsere natürlichen Grundlagen. Das ist kein tragfähiges Konzept.
Viele halten «grünes Wachstum» für eine Lösung, zumindest für die ökologischen Probleme. Das Ziel dabei ist, das BIP zu steigern, aber gleichzeitig Umwelt und Ressourcen zu schonen, zum Beispiel mithilfe neuer Technologien. Was halten Sie davon?
Grünes Wachstum klingt erst mal wunderbar. Es gibt inzwischen viele Institutionen, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel die OECD mit ihren Green Growth Reports. Aber ich bin skeptisch. Es reicht eben nicht, wenn wir weiter wachsen und dabei unseren Verbrauch an Ressourcen konstant halten. Wir müssten ihn stark senken – und zwar möglichst bald! Im Moment deutet wenig darauf hin, dass das gelingt. Ich denke, dass so viele Menschen auf grünes Wachstum setzen, zeigt nur, wie fixiert wir inzwischen auf das Konzept «Wachstum» sind.
Unsere Art zu wirtschaften, zerstört den Planeten
Würden Sie empfehlen, dass unsere Wirtschaft gar nicht mehr wachsen soll, wie es Degrowth- oder Post- wachstums-Anhänger befürworten?
Ich habe mich lange mit dieser Frage beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir im Hinblick auf Wachstum agnostisch sein sollten, es also ignorieren sollten. Denn unsere Art zu wirtschaften zerstört den Planeten. Wir müssen das ganze System von Grund auf neu denken. Nur dann haben wir eine Chance, unsere natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu erhalten. Und das muss doch unser Ziel sein.
Sie sind nicht die Erste, die Kritik übt an der Art, wie wir wirtschaften. Aber wie schaffen wir es denn, davon wegzukommen?
Es gibt ein tolles Zitat von dem Architekten und Philosophen Richard Buckminster Fuller. Er hat gesagt: «Du änderst niemals Dinge, indem du sie bekämpfst. Baue ein neues Modell, das das alte überflüssig macht.»
Deshalb Ihr Donut Modell. Beschreiben Sie es doch bitte mal genauer.
Es ist ein neuer Ansatz, der vor allem Wirtschaftswissenschaftler anleiten soll, neue Modelle und Handlungsoptionen auszuarbeiten. Der Donut soll dabei eine Art Richtschnur sein. Das Ziel ist, die Bedürfnisse eines jeden Menschen auf der Welt zu befriedigen und dabei gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, also unsere natürlichen Ressourcen zu schützen.
Die natürlichen Ressourcen sind also Teil des Modells, anders als bei heutigen ökonomischen Modellen.
Richtig! Mein Donut-Modell zeigt eine äußere Grenze, die wir verlassen, wenn wir über die Belastungsgrenze unseres Planeten hinausgehen. Etwa wenn wir zu viel Süßwasser verbrauchen, zu viel CO2 emittieren oder zu viele Gifte in Gewässer und Böden einleiten. Dann kommt es zum Klimawandel, zur Versauerung der Meere, zum Verlust der Artenvielfalt und so weiter. Nur wenn wir so wirtschaften, dass wir nicht über diese äußere Grenze hinausschießen, können wir die natürlichen Ressourcen unseres Planeten auf Dauer erhalten.
Wofür steht die innere Grenze des Donuts?
Sie steht dafür, dass jeder Mensch auf diesem Planeten Bedürfnisse hat, die befriedigt werden müssen. Dazu gehören materielle Dinge wie sauberes Wasser, Energie und ausreichend Nahrung, aber auch soziale Bedürfnisse wie politische Teilhabe und Bildung. Wir dürfen auch diese innere Grenze nicht reißen, denn sonst sind diese elementaren Bedürfnisse nicht gedeckt. Die grundlegende Frage ist: Wie können wir Ressourcen so einsetzen, dass wir weder unsere natürlichen Grundlagen zerstören noch Menschen auf der Welt Mangel leiden müssen? Wenn wir das schaffen, sind wir im Bereich des Donuts. Das ist der Bereich, in dem die Menschheit sicher und gerecht leben kann.
Wie lautet Ihre Antwort?
Ich habe darauf keine fertige Antwort, ich sage vielmehr, das sind die Themen, mit denen sich die Ökonomen des 21. Jahrhunderts im Detail beschäftigen sollten. Eine Frage könnte beispielsweise lauten: Wie müssen Unternehmen strukturiert sein, damit ihre Produkte die materiellen Bedürfnisse der Menschen befriedigen und gleichzeitig natürliche Ressourcen erhalten? Eine andere könnte lauten: Welche Art von Märkten könnte uns dabei helfen, in den Donut zu kommen?

Wenn ich «Donut» höre, denke ich an etwas, das fettig und überzuckert ist. Warum haben Sie Ihr Modell eigentlich so benannt?
Es ist ein verrückter Titel, ich weiß (lacht). Wenn ich mein Modell irgendwo vorstelle, sage ich immer zuerst: Dieser Donut ist der einzige, der gut für Sie ist. Es war am Anfang gar nicht meine Idee, das Modell so zu nennen. Ich habe mein Diagramm einem Wissenschaftler gezeigt, und der sagte: «Oh, es sieht aus wie ein Donut.» Das hat sich bei mir festgesetzt, und letztlich habe ich mich bewusst für den Titel entschieden.
Warum?
Weil er witzig ist und im Gedächtnis bleibt. Die Leute fragen sich sofort, was damit gemeint ist. Sie wollen mehr erfahren. Ich versuche immer, die Menschen auf verschiedene Weise zu erreichen. Nicht nur mithilfe von Humor, sondern auch mit Bildern, die im Gedächtnis bleiben. Meinen Studenten zeige ich immer ein Video von einem Vogelschwarm am Abendhimmel. Haben Sie ein Bild vor Augen?
Vögel, die im Gleichklang fliegen, sodass es wie eine perfekte Formation aussieht.
Beeindruckend, oder? Jeder einzelne Vogel dreht und wendet sich im Flug und schafft es auf phänomenale Weise, eine Flügelspanne Abstand zu seinen Nachbarn zu halten. Wenn sich zehntausende Vögel versammeln, wird der Schwarm zu einer einzigen vorwärtsdrängenden, pulsierenden Masse am Himmel.
Aber was hat die Betrachtung eines Vogelschwarms mit Ökonomie zu tun?
Von der Natur können wir unglaublich viel lernen. Überall finden wir zum Beispiel selbstregulierende Ökosysteme, die über Rückkopplungen intakt bleiben. Soll heißen: Es gibt Zu- und Abflüsse, Auf- und Abwärtsspiralen, sodass ein System stabil bleibt. Auch Aktienmärkte kann man als solch ein dynamisches System verstehen. Viele Menschen kaufen Aktien, weil andere Menschen Aktien kaufen. Oder sie verkaufen, weil sie sehen, dass andere verkaufen. Zu- und Abflüsse, das System bleibt intakt. Aber es ist auch möglich, dass das System überhitzt. Es schießt weit hinaus, und dann kommt es zu einem Punkt, wo es plötzlich kippt, das ist der sogenannte «tipping point». Bei den vergangenen Finanzkrisen haben wir gesehen, dass dafür oft banale Auslöser reichen. Plötzlich crasht die Börse. Beim Klima ist es genauso.
Inwiefern?
Wir pusten jeden Tag CO2 in die Umwelt, und es scheint erst mal wenig zu passieren. Bis zu einem bestimmten Punkt, dann kippt das System plötzlich, das ganze Eis in der Arktis schmilzt und der Meeresspiegel steigt dramatisch an.
Nichts in der Natur wächst ewig, außer Krebs.
Aus dieser Perspektive haben Finanzmärkte und unser Klima mehr gemeinsam, als man zunächst denkt. Gibt es denn Ökonomen, die das Wirtschafts- system auf diese Weise erforschen?
Die Komplexitätsökonomie ist eine relativ neue For- schungsrichtung. Hyman Minsky war einer der ersten, der Finanzmärkte als dynamische Systeme analysiert hat. Er kam übrigens zu dem Schluss, dass Finanzmärkte ruinös sind, weil sie destabilisierende Kräfte entwickeln, zumindest wenn sie nicht reguliert werden. Minsky ist 1996 gestorben, seine Ideen erleben seit der Finanzkrise ein Comeback. Aber das ist nur ein neuer Ansatz. Es gibt viele Möglichkeiten, die Wirtschaft aus neuer Perspektive zu betrachten. Es ist wichtig, dass wir wegkommen von diesem einfachen linearen Denken – die Wachstumskurve steigt immer weiter – und stattdessen komplexere Modelle entwickeln. Nichts in der Natur wächst ewig, außer Krebs. Das lineare Denken in der Ökonomie stammt noch aus den 60er-, 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Märkte entwickeln sich aber nicht linear, es sind dynamische Systeme. Auch viele Mainstream-Ökonomen wissen, dass ihre Modelle nicht mehr zeitgemäß sind.
Der Eindruck drängt sich mir nicht unbedingt auf.
Der ehemalige US-Notenbanker und sehr einflussreiche Ökonom Alan Greenspan hat 2008 in einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress zugegeben, dass er die Selbstheilungskräfte der Märkte überschätzt hat und dass die Mainstream-Ökonomie die Finanzkrise eigentlich nicht erklären kann. Das war schon eine Art Bankrotterklärung der gesamten Zunft.
Finanzmärkte sind menschengemacht
Dennoch hat man das Gefühl, dass seitdem nicht viel passiert ist.
Weil es gar nicht so einfach ist, diese Dinge zu ändern. Unsere ganze Gesellschaft, unsere Institutionen sind auf Wachstum ausgerichtet. Nehmen Sie zum Beispiel die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie ist Anfang der 1960er-Jahre gegründet worden, um das Wachstum in den Mitgliedsländern zu fördern. Wobei auch die OECD selbstkritischer geworden ist. Aber es reicht eben nicht, das BIP zu ersetzen. Es gibt ja bereits andere Kennzahlen, zum Beispiel den «Better Life Index». Das wäre ein guter Anfang, aber das eigentliche Problem sitzt tiefer.
Was meinen Sie damit?
Unsere Finanzmärkte beispielsweise sind so strukturiert, dass sie die Unternehmen mit den höchsten Renditen belohnen. Börsennotierte Firmen müssen ihren Aktionären jedes Vierteljahr die Umsätze präsentieren. Um gut dazustehen, müssen sie ihren Kunden deshalb immer mehr verkaufen. Andernfalls stoßen die Aktionäre die Wertpapiere der Firma ab, Aktienkurs und Unternehmenswert sinken. Wenn das sehr viele Aktionäre machen, geht die Firma pleite. Aber Finanzmärkte sind keine natürlichen Systeme; sie sind menschengemacht, man kann sie anders designen.
Das wäre eine Aufgabe für Politiker.
Richtig, aber auch Politiker haben ihre Zwänge. Schauen Sie sich zum Beispiel die «G20» an. Ich spreche immer von der G20-Familie, weil die Fotos solcher Treffen mich an Fotos von Großfamilien erinnern, wo alle nebeneinander aufgereiht sind. Die G20 heißen so, weil sie die 20 wichtigsten Ökonomien der Welt sind. Und woran bemisst sich das? Am BIP! Kein Politiker will seinen Platz in der Familie verlieren. Deshalb müssen die Länder weiter wachsen, und zwar umso schneller, je schneller die anderen wachsen. Sonst werden sie überholt. Oder nehmen Sie das Geld, das ein Staat zur Verfügung hat. Einnahmen hat ein Land vor allem durch Steuern. Kein Politiker will Steuern erhöhen, das ist sehr unpopulär. Was kann er also tun? Er kann Wachstum fördern. Auf diese Weise hat der Staat automatisch mehr Steuern. Was ich damit sagen will: Wir sind auch politisch auf Wachstum eingeschworen.
Was schlagen Sie vor?
Wir müssen die Wachstumsabhängigkeit unserer Gesellschaft verringern, in all ihren Facetten. Das ist die Aufgabe unserer Generation. Dafür brauchen wir mutige Politiker, die das auf den Weg bringen. Aber die wiederum brauchen die Expertise von Wissenschaftlern, die aufzeigen, wie das funktionieren kann. Und genau da möchte ich ansetzen. Ökonomen des 21. Jahrhunderts müssen neue Ideen entwickeln. Mein Donut-Modell soll dafür der Kompass sein. Denn in den alten Lehrbüchern der Ökonomie finden wir keine Lösungen – weil die Ökonomen der vergangenen Jahrhunderte unsere heutigen Probleme gar nicht vor Augen hatten.
Kate Raworth lehrt am «Environmental Change Institute» der University of Oxford und am «Cambridge Institute for Sustainability Leadership» der University of Cambridge und ist Mitglied im Club of Rome. Zuvor hat sie mit Mikro-Entrepreneuren in Sansibar gearbeitet, war Ko-Autorin des Human Development Reports der Vereinten Nationen und Senior Reseacher bei Oxfam. Ihr Buch «Doughnut Economics» ist in viele Sprachen übersetzt worden und im März 2018 auf Deutsch bei Hanser erschienen.