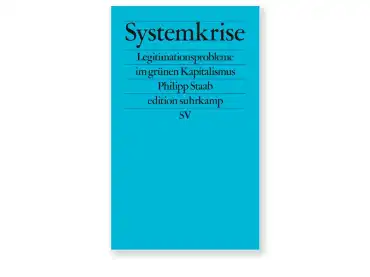«Es wird nicht mehr an eine bessere Zukunft geglaubt»
Philipp Staab im Gespräch mit Guido Speckmann
Der Soziologe analysiert, warum die Angst um die eigene Lebenswelt heute jede Vision blockiert – und was das für den gesellschaftlichen Wandel bedeutet.
Kurz vor dem Gesprächstermin mit Philipp Staab Ende August 2025 hat Robert Habeck in einem viel diskutierten taz-Interview seinen Rückzug aus der Politik begründet. Der Grünen-Politiker, einst beliebtester Politiker Deutschlands und als Minister für Klima und Wirtschaft der Ampel-Koalition Gesicht einer klimapolitischen Modernisierung, klingt darin fast wie ein Soziologe, wenn er über seine Erfahrung im Ministeramt sagt: Die Gesellschaft habe vielleicht gar keine Mitte, sondern bestehe aus lauter Gruppen, die verschiedene Interessen artikulieren und die sich nur noch rhetorisch auf eine Gemeinsamkeit beziehen.
In der aktuellen Klimapolitik scheint diese Analyse ihre Entsprechung zu finden. Rhetorisch bekennt sich die schwarz-rote Koalition zwar zum Klimaschutz, doch in der Praxis torpediert sie ihn mit Maßnahmen und Gesetzesvorhaben, sobald Interessengruppen Druck machen: Gaskraftwerke sollen ausgebaut, CO2 anstatt reduziert im Boden abgeschieden, der Ausbau Erneuerbarer Energien einem Realitätscheck unterzogen werden, und das Verbot für Verbrennerautos ab 2035 wird infrage gestellt. Das Projekt der ökologischen Modernisierung scheint gescheitert zu sein. Habecks Abgang, der sich in sinkenden Umfragewerten schon lange angedeutet hatte, ist das Symbol dafür.
Die tieferliegenden Ursachen für dieses Scheitern hat Philipp Staab in seinem neuen Buch «Systemkrise – Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus» analysiert. Wir trafen ihn in den Räumen des Instituts für die Geschichte und Zukunft der Arbeit in Berlin-Kreuzberg und fragten nach.
Herr Staab, Robert Habeck sagte im Interview zu seinem Rückzug, dass Gruppen ihre eigenen materiellen lebensweltlichen Interessen immer höher bewerten würden als das rhetorisch beschworene Gemeinsame. Was halten Sie von dieser Beobachtung?
Habeck scheint damit auf einem wichtigen Pfad zu sein. Nämlich, dass sich die Proteste gegen verschiedene Formen von Politik – er meint sicher die ökologische Modernisierung – aus lebensweltlich strukturierten Motiven speisen. «Lebensweltlich» bedeutet, dass die Motive aus persönlichen alltäglichen, normativen Vorstellungen darüber stammen, was gut und richtig ist. Die Lebenswelt prägt die Gefühlsstruktur der Leute. Was mir nicht richtig erscheint, ist Habecks Aussage, dass die Orientierungen der Menschen im Kern von materiellen Interessen bestimmt werden.
Spielen diese denn keine Rolle?
Doch, materiellen Interessen kommt eine Rolle zu. So kann jemand mit einem Professorengehalt dem sogenannten Heizungsgesetz beruhigter entgegensehen als mit dem Einkommen einer Erzieherin. Es greift jedoch zu kurz, im Umkehrschluss davon auszugehen, alle würden die «richtige Politik» unterstützen, wenn sie nur genügend materiell abgefedert werden. Dann hätte es den Konflikt um das Heizungsgesetz nie geben dürfen. Denn es gab das Versprechen, dass die Leute am Ende höchstens so viel zahlen wie für die Gasheizung – und langfristig sogar weniger. Zudem existieren entsprechende Förderprogramme. Ein anderes Beispiel ist der Kohleausstieg in der Lausitz: Würde materieller Ausgleich automatisch für Zustimmung sorgen, dann dürften in der Region nicht 40 Prozent der Wähler:innen die AfD wählen. Die Kohlekumpel sind schließlich sozialverträglich aus ihren Jobs ausgeschieden und wurden nicht im Regen stehen gelassen. Milliarden sind in die Region geflossen.
Aber die Hauptkritik beim Heizungsgesetz war anfänglich doch die soziale Komponente – die wurde ja erst später nachgeschoben.
Dass das Gebäudeenergiegesetz handwerklich nicht gut war und schlecht kommuniziert wurde, bestreite ich nicht. Aber angenommen, es gäbe ein Grundvertrauen in die Politik, dann würden die Leute doch darauf warten, bis die Politik nach anfänglicher Kritik das Gesetz ausbuchstabiert und verbessert. Stattdessen setzt sich eine Suggestion durch, die sowohl medial als auch politisch befeuert wird. Bestes Beispiel dafür ist die Aussage von Mario Voigt, damals Thüringens CDU-Chef, der von einer «Energie-Stasi» und einem «Schnüffel-Staat» sprach. Das triggert die Leute und löst Abwehrreaktionen aus. Ihnen wird suggeriert, der Staat wolle in ihren privaten Bereich eindringen und ihnen etwas aufzwingen.

Wenn also nicht die materiellen Aspekte ausschlaggebend sind für den Widerstand gegen ökologische Modernisierungsmaßnahmen, was dann?
Wir müssen verstehen, dass sich in der Gesellschaft etwas fundamental verändert hat. Materielle Konflikte spielen weiterhin eine Rolle, doch seit den späten 1980er-Jahren ist eines zunehmend bewusst geworden: Die industriegesellschaftliche Logik, die auf dem Ausgleich materieller Interessen basiert und auf politischen Prozessen, die sich vor allem um Kapital und Arbeit sowie um soziale Ungleichheit und sozialen Aufstieg drehen, ist Geschichte. Stattdessen wird die Gesellschaft immer stärker mit den Folgen ihrer eigenen Modernisierung konfrontiert – vor allem dem Klimawandel und anderen ökologischen Krisen. Zunächst war das eine abstrakte Erwartung, doch mit zunehmender Häufigkeit von Katastrophen wie im Ahrtal, Hitzewellen, Dürren und Waldbränden auch im Globalen Norden werden sie zur konkreten Erfahrung. Das sehen wir auch in Umfragen: Die Menschen sind sich bewusst, dass wir uns in einer planetaren Selbsterhaltungskrise befinden, sie wissen, dass der Klimawandel die Superkrise ist. Gleichzeitig werden die Lebensrealitäten durch weitere Krisen verschärft – von steigenden Mieten und Armut bis hin zu Inflation, Pandemie, wirtschaftlicher Stagnation und Krieg. In solch einer Situation anzunehmen, Geld alleine könne die Leute beruhigen, ist falsch.
Ist das die «Identitätskrise spätmoderner Gesellschaften», von der Sie in Ihrem Buch «Systemkrise» sprechen?
Ja. Es gibt mittlerweile eine tiefgreifende Beunruhigung darüber, wie sich unsere Lebensweise angesichts des Klimakollapses überhaupt noch aufrechterhalten lässt. Das Muster hochmoderner Gesellschaften war es, die Systemkrisen des Kapitalismus durch sozialstaatliche Leistungen zu kompensieren. Sie basierten darauf, dass Probleme in der Zukunft bearbeitet werden. Morgen wird es euch besser gehen, lautete das Versprechen. Die Zukunft war ein weißes Blatt, bereit, beschrieben zu werden. Das ist heute passé, es wird nicht mehr an eine bessere Zukunft geglaubt.
In Ihrem Buch sprechen Sie von einem «ökopolitischen Paradox». Was verstehen Sie darunter?
Es beschreibt die Situation, dass die allergrößten Teile der Gesellschaft angesichts der ökologischen Krise schon länger massiv beunruhigt sind. Gleichzeitig empfindet ein wachsender Teil diese nicht als primäre Bedrohung, sondern als Verlust ihres gewohnten Lebensstils. Er ist nicht bereit, die angebotenen Modernisierungsprozesse mitzutragen, und verhindert sie sogar aktiv. Ich vergleiche das im Buch so: Die meisten Menschen haben zwar Angst vor den Flammen, die das sinnbildliche Gesellschaftshaus bedrohen. Aber gegen die politischen Löschversuche regt sich großer Unmut bis zu dem Punkt, dass die Feuerwehr davongejagt wird.
Liegt das daran, dass die Menschen das Ausmaß der Krise noch nicht verstanden haben?
Ganz und gar nicht. Sie wissen nicht zu wenig über die Klimakrise und sind auch keineswegs zu wenig beunruhigt. Im Gegenteil: Sie sind so beunruhigt, dass sie diese Probleme regelrecht abwehren müssen. Es hilft ihnen, dass der Alltag vorerst noch normal weiterläuft, obwohl ihnen das Risiko eines kommenden Klimakollapses bewusst ist. Wird diese Abwehr jedoch durchbrochen, führt das zu Aggressionen.
Wo zeigen sich diese Aggressionen?
Zum Beispiel bei den Straßenblockaden der «Letzten Generation». Berufspendler:innen stehen zwar dauernd im Stau, aber wenn dieser durch Aktivist:innen verursacht wird, die auf die verdrängte Klimakrise aufmerksam machen, kommt es zu Handgreiflichkeiten und Gewalt – nicht nur hierzulande, sondern auch in Italien und Großbritannien. Wenn die Menschen die ökologische Krise kalt ließe, bräuchten sie nicht so krass reagieren. Das sehen wir auch bei Themen wie der Beschränkung neuer Einfamilienhäuser in Hamburg, der Ausweisung von Flächen für Windräder oder der fleischlosen Ernährung – überall kochen die Emotionen hoch. Viele haben das Gefühl, dass schon kleine Veränderungen ihre gesamte Lebenswelt infrage stellen.

Sind das die «politischen Kipppunkte», die Sie in Ihrem Buch beschreiben?
Es ist ihre Grundlage. Diese Mentalitäten untergraben die Basis der liberalen Demokratie, die theoretisch auf der bereits erfolgten Lösung von Selbsterhaltungsproblemen beruht. Der englische Philosoph Thomas Hobbes hat argumentiert, Voraussetzung des liberalen Staates sei, dass er die Bürger:innen mithilfe des Gewaltmonopols von ihren fundamentalsten Selbsterhaltungsängsten entlastet. Dieses Sicherheitsgefühl fehlt heute. Stattdessen fühlen sich viele Menschen wieder in Hobbes’ beschriebenen Urzustand versetzt, in dem es darum geht, das Gewohnte gegen Gefährdungen zu verteidigen.
Dabei verspricht die ökologische Modernisierung sogar, dass der Lebensstil weitgehend erhalten bleibt. Statt eines Verbrenners kann man einfach das E-Auto nutzen, von Tempolimit keine Spur.
Die grüne Modernisierung ist ein Kompromiss, der niemanden so richtig glücklich macht. Eine Zeitlang funktionierte er halbwegs, weil er Wachstum und Kapitalismus nicht infrage stellte und verschiedene gesellschaftliche Gruppen vereinte: wachstumsorientierte Liberale, ökologisch beunruhigte Bürger:innen, Teile des konservativen Spektrums und der Wirtschaft. Der Kompromiss des grünen Kapitalismus stößt jedoch an seine Grenzen, wenn er in die Lebenswelten der Bürger:innen eingreifen muss – etwa beim Heizungsgesetz. Ökologische Modernisierung löst so subjektiv massive Zumutungen aus – und das, obwohl sie eigentlich weiterhin auf die Externalisierung von Klima- und Umweltproblemen setzt, um die heimischen Verhältnisse stabil zu halten.
Wieso externalisiert sie sie nur?
Weil der grüne Kapitalismus die systematische Verschiebung ökologischer Schäden fortsetzt. Für die Herstellung von Batterien, Solarpaneelen und Windrädern werden Rohstoffe benötigt, deren Abbau im Globalen Süden verheerende Umweltprobleme verursacht. Die Treibhausgasemissionen im Globalen Norden sind auch deshalb gesunken, weil die Produktion vor allem nach China verlagert wurde und die Waren importiert werden. Signifikante CO2-Reduktionen sehen wir weltweit nur in den Rezessionsjahren infolge der Weltwirtschaftskrise 2008 und der Corona-Pandemie.
Was treibt die «antiökologischen Aufständischen», wie Sie die Gegner:innen des ökologischen Modernisierungsprojekts nennen, an?
Im Kern ist es ihre Sehnsucht nach einem Ausgang aus der Ohnmacht. Sie empfinden sich im Angesicht der Klimakrise nicht als handlungsfähig. Wir alle wissen, dass Mülltrennen und das gelegentliche Kaufen von Ökoprodukten den Planeten nicht retten werden. Daher muss die Sehnsucht nach Handlungsfähigkeit anders befriedigt werden. Hier kommt der Rechtspopulismus mit seiner Politik der Projektionen ins Spiel. Die Ohnmacht angesichts fundamentaler Selbsterhaltungsängste wird dadurch kompensiert, dass man sich mit vermeintlich leichter zu lösenden Problemen profiliert: Statt einer ökologischen Modernisierung geht die Ampel krachen und wir bekommen die Simulation von Grenzkontrollen. Das suggeriert Handlungsfähigkeit. Eine andere Form der Projektion, die überall in der Gesellschaft zu finden ist, ist die Hoffnung auf Technologien, die irgendwann erfunden werden und helfen sollen, den Klimawandel zu bremsen. Technologie ist eine kompensatorische Instanz für Handlungsfähigkeit, die in der Gegenwart nicht existiert.
Sie haben mit Studierenden 72 qualitative Interviews mit Beschäftigten aus Kernbranchen der ökologischen Modernisierung geführt – und dabei nicht die erwarteten begeisterten Unterstützer:innen gefunden. Wie erklären Sie sich die Ergebnisse, die Sie in Ihrem Buch beschreiben?
Nach der Auswertung der Interviews haben wir drei Lebenswelten identifiziert: die der Abwehr, die des Kapitals und die des Engagements. In der Lebenswelt der Abwehr, beispielsweise bei grünen Handwerksberufen, hat man sich im Grunde damit abgefunden, dass der ökologischen Krise nicht mehr beizukommen ist. In der Lebenswelt des grünen Kapitals, bei Gründer:innen und Beschäftigten von grünen Start-ups – wir nennen sie die Ökomodernen –, sieht man die grüne Modernisierung als Welle, auf der man zum wirtschaftlichen Erfolg surft. Einzig in der Lebenswelt des Engagements, oft von akademisch gebildeten Personen oder solchen, die die Auswirkungen von Klimawandel und Artensterben in ihren Berufen erleben, gab es eine nennenswerte Unterstützung für das Projekt der ökologischen Modernisierung, als dieses unter Beschuss geriet. In der Lebenswelt der Abwehr fanden wir hingegen auch das, was wir «Folgebereitschaft gegen Schutz» nennen: Die Beschäftigten, etwa in der Autoindustrie, sind prinzipiell bereit, an der grünen Transformation mitzuwirken, solange die Stabilität der eigenen Lebenswelt dadurch nicht gefährdet wird.

Erstaunt haben mich die in Ihrem Buch aufgeführten Zitate aus der Lebenswelt des grünen Kapitals – sie erscheinen mir sehr neoliberal.
Das kann man so sagen. Bei den Akteur:innen, die im Kontext der grünen Modernisierung der Wirtschaft wirklich über relevante Ressourcen verfügen, etwa Investitionskapital oder Schlüsselpositionen in Unternehmen, wird diese primär als wirtschaftliche Gelegenheit gesehen. Ökologische Motive spielen keine große Rolle. Gleichzeitig wünscht man sich einen autoritären Expertenstaat, der die eigenen wirtschaftlichen Interessen im Zweifelsfall auch gegen die Bevölkerung absichert und begünstigt.
In Ihrem Buch nennen Sie Donald Trump und Elon Musk «Prototypen» eines neuen Politikertyps. Als «unternehmerische Akteure» scheinen sie besser dazu in der Lage zu sein, die Emotionen der Menschen für sich zu gewinnen, als klassische «Berufspolitiker:innen». Sind künftig auch «Öko-Musks» denkbar?
Das ist vorstellbar, und es gibt sie sogar schon. Ein schillerndes Beispiel ist Dale Vince aus England. Er ist Eigentümer des grünen Energieunternehmens «Ecotricity» und hat als Präsident des Fußballclubs Forest Green Rovers im Jahr 2010 das erste Stadion aus Holz gebaut. Solche Unternehmer sind im progressiven Spektrum jedoch selten, sie werden oft als Außenseiter im politischen Betrieb und als fähig wahrgenommen, Dinge zu bewegen – auch das ein Ausdruck der Sehnsucht nach Handlungsfähigkeit. Es kommt darauf an, ob diese «Öko-Musks» politische Kraft entfalten können. Das ist zwar möglich, ich halte es aber für wenig wahrscheinlich, dass so derzeit eine erfolgreiche ökologische Politik gemacht werden kann.
Sie schreiben, die «Ökomodernen» seien den «antiökologischen Aufständischen» erstaunlich ähnlich. Warum?
Beide Gruppen stehen unter dem Eindruck fundamentaler Selbsterhaltungsängste und sind daher unfähig, ökologische Politik durchzusetzen. Die antiökologischen Aufständischen lehnen diese aggressiv ab und gehen auf die Straße – wie bei den Bauernprotesten gegen die Abschaffung von Dieselsubventionen. Die Ökomodernen handeln aus einer Haltung der Besserwisserei heraus. Sie glauben, den ökologischen Wandel voranbringen zu können, wenn die Politik sie nur ließe. Sie brauchen die Politik als Buhmann, um ihre eigene imaginierte Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Der Soziologe Dennis Eversberg hat vor einem Jahr im Energiewende-Magazin eine Lanze für die soziale Gleichheit bei der Bekämpfung des Klimawandels gebrochen. Mehr Gleichheit sorgt für eine Emissionsreduktion bei denjenigen, die am meisten Klimagase ausstoßen: den Reichen und Superreichen. Könnte das die ökologische Modernisierung voranbringen?
Es kommt darauf an. So wie dieser Ansatz in den politischen Prozess einfließt, ist er vergleichsweise sozialdemokratisch – etwa wenn soziale Lasten wie beim Kohleausstieg abgefedert werden. Aber das erzeugt keine Unterstützung für den grünen Kapitalismus. Auf der anderen Seite wird die Frage der Gleichheit im linkeren Spektrum als Klimapopulismus thematisiert. Es ist richtig: Superreiche sind ein massives ökologisches Problem. Aber wenn wir die Produktion von Jachten für Superreiche verbieten und gleichzeitig erlauben, dass die Ressourcen für viele kleine Boote genutzt werden, ist damit zwar verteilungspolitisch etwas gewonnen, aber es werden genauso viele Emissionen ausgestoßen und Ressourcen verbraucht wie bei den Superjachten. Man muss also auch an die Wachstumsfrage rangehen. Wenn du das machst, gibt es jedoch weniger zu verteilen.
Also beurteilen Sie die auf soziale Gleichheit abzielenden Ansätze eher skeptisch?
Politisch können sie zeitweise erfolgversprechend sein. Gleichzeitig glaube ich aber, dass solche Ansätze auf einem falschen Verständnis des Politischen beruhen: Sie wollen letztlich Modernisierung fortschreiben, nur eben anders als bisher. Das setzt die Fähigkeit voraus, langfristig strategisch handlungsfähig zu sein. Politik wird heute aber immer stärker durch Ereignisse wie die Pandemie, die Auseinandersetzung um das Gebäudeenergiegesetz oder den russischen Angriff auf die Ukraine geprägt. Der gesamte politische Prozess dreht sich dann ausschließlich darum. Das heißt auch, dass sich in diesen Momenten Dinge schnell verändern können. Statt langfristiger Strategien wird die Fähigkeit zu taktieren wichtiger. Es geht darum, günstige Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Eine «okkasionalistische Politik», wenn Sie so wollen.
Wie könnte denn eine progressive Politik hierauf reagieren?
Zunächst sollte sie verstehen, wie der politische Prozess heute funktioniert. Während der Pandemie ergab sich kurzzeitig die Möglichkeit, den Sozialstaat auszubauen. Die Gelegenheit hat die progressive Linke verstreichen lassen. Da standen die Leute auf den Balkonen und klatschten den Pflegekräften und Ärzt:innen Beifall. Sie machten deutlich, dass es ein Drittel der Gesellschaft gibt, das unerlässlich für das Funktionieren des Alltags ist, und dass dort mehr Ressourcen hinmüssen.
Warum wurde diese Chance nicht genutzt?
Weil man sich zu sehr auf langfristige Strategien und inhaltsleere Wahlkämpfe fixiert und nicht in der Lage ist, akute Probleme, die in der Lebenswelt wurzeln, zu politisieren. Die Rechte hat das übrigens bereits verstanden. Sie bespielt die politischen Kipppunkte, indem sie die Diskurse entsprechend prägt. Das heißt jedoch nicht, dass wir bereits unaufhaltsam den Pfad des Abrutschens in faschistische Zustände beschritten haben. Die neue Rechte verfügt nicht über die soziale Basis des historischen Faschismus.
Weil sie ebenso mit der Entkollektivierung der Gesellschaft konfrontiert ist wie alle anderen?
Ja, die wirklich kollektiven Strukturen werden so schnell nicht zurückkommen. Alles, was diese neue Konstellation stabilisieren könnte, fehlt. Es ist jetzt nur in diese Richtung gekippt, kann aber auch in die andere kippen. Eine Erkenntnis wäre: Wandel war noch nie so schnell und unerwartet möglich wie heute.
Und was bedeutet das für die Umwelt- und Klimabewegung?
Sie muss darauf vorbereitet sein, dass unerwartete Gelegenheiten auftauchen können. Als Leitbild sollte weder grünkapitalistische technokratische Klimapolitik dienen noch Träumereien von einer ökologischen Klasse. Sie müsste sich vielleicht eher am Modell der politischen Avantgarde orientieren: weniger «listen to science», mehr «game the system».
Philipp Staab, 1983 in Nürnberg geboren, ist Professor für Soziologie von Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel an der Humboldt-Universität zu Berlin und Vorstandsmitglied des Einstein Center Digital Future. Sein bei Suhrkamp erschienenes neues Buch «Systemkrise – Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus» hatte auf der «Langen Nacht des Klimas» im September 2025 Berliner Buchpremiere.
-

«Die Stimmung der gesellschaftlichen Mitte hat sich verschoben»
Mit gezielt geschürter Wut wird bei vielen das Bedürfnis nach dem Erhalt des Status quo bedient. Wie ist diesem Empörungswettbewerb noch beizukommen?
-

«Wie schaffen wir eine machtvolle Gegenkultur?»
Die Fakten zur Klimakrise sind klar. Doch wir als Gesellschaft müssen ins Handeln kommen. Ein abendlicher Austausch in der «Kulturfabrik Moabit».