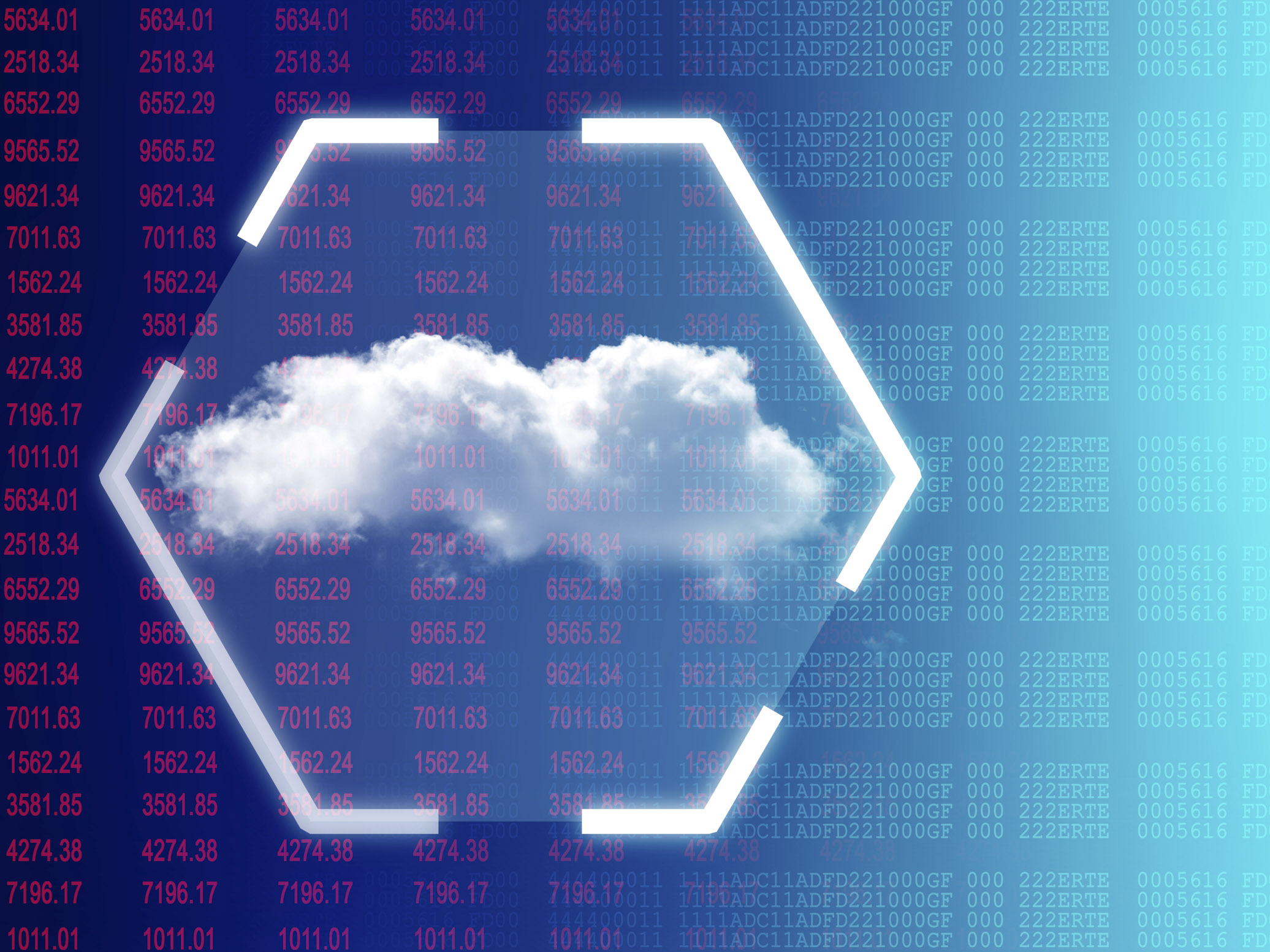Klimaklagen weltweit Biss verleihen
Die Klimajuristin Joana Setzer im Gespräch mit Christian Mihatsch
Mit einer Datenbank für Klimaurteile unterstützt Joana Setzer Menschen, die Klimaklage erheben. Das macht Gerichte mutiger – und Konzernchefs nervös.
Bahnbrechend», «Erdbeben», «wichtigste klimapolitische Entscheidung» – so lautete im Frühjahr 2021 das Presseecho auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. In diesem legte es fest, dass das Klimaschutzgesetz teilweise verfassungswidrig sei. Wenige Wochen später schärfte die Bundesregierung das deutsche Klimaziel nach: Statt um 55 Prozent gegenüber 1990 sollen die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent sinken. Außerdem will Deutschland schon 2045 und nicht erst 2050 klimaneutral wirtschaften.
Das zeigt, dass Gerichte entscheidende klimapolitische Weichen stellen können. Viele weitere Klimaurteile und -gesetze aus aller Welt sammelt die Juristin Joana Setzer in der hierfür angelegten Datenbank «Climate Change Laws of the World». Ursprünglich als Umweltanwältin in Brasilien tätig, hat sie sich am «Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment» in London auf Klimaprozesse spezialisiert. Die von ihr gesammelten Datensätze dienen dazu, die Rechtslage und die Gerichtspraxis aller Länder online zugänglich zu machen: Richter können sehen, wie ihre Kollegen andernorts urteilen, Kläger, welche Argumentationen Erfolg versprechen – und Unternehmen, welchen juristischen Risiken sie ausgesetzt sind. Im Interview mit dem Energiewende-Magazin klärt Joana Setzer, welche Rolle Klimaklagen insgesamt spielen, was die wichtigsten Urteile sind und ob der Präsident ihres Heimatlands Brasilien des «Ökozids» beschuldigt werden kann.

Frau Setzer, der Kampf gegen die Klimaerwärmung ist Aufgabe der Parlamente und Regierungen. Zuletzt sorgten aber immer wieder Klimaurteile von Gerichten für Aufsehen. Welche Rolle spielt die Judikative in der Klimapolitik mittlerweile?
Wenn von der Politik ungenügende Maßnahmen ergriffen werden, hat das immer häufiger Klimaklagen zur Folge. Sie bilden ein weiteres Instrument neben der Innenpolitik und der sehr langsamen außenpolitischen Entwicklung. Die Klagen sind auch wichtig, um Regierungen dazu zu zwingen, die Klimavereinbarungen von Paris einzuhalten. Das Abkommen selbst verfügt über keinen Mechanismus, der dies ermöglichen würde. Aber nationale Gerichte können ihm Biss verleihen.
Sie sind Co-Autorin des dritten Bands des «Sechsten Sachstandberichts» des Weltklimarats (IPCC), der 2022 erscheint. Was ist Ihr Beitrag zu diesem Bericht?
Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut – auch weil der IPCC die Bedeutung von Klimaklagen zur Durchsetzung einer effektiven Klimapolitik lange nicht erkannte. Das hat sich jetzt geändert. Mittlerweile konnten wir zudem eine ausreichende Zahl an Studien sammeln, sodass Klimaklagen im IPCC-Bericht angemessen berücksichtigt werden können. Ich habe daher die Entwicklung beschrieben und zeige auf, wie Klimaklagen das Verhalten von Regierungen und Firmen beeinflussen.
Auch das von Firmen?
Klagen sind ein Werkzeug, um auf vielen verschiedenen Ebenen voranzukommen. Es gibt Klagen gegen Großunternehmen, Banken und Investoren. Deren Rechtsabteilungen beginnen endlich, nervös zu werden – insbesondere, wenn es um Klagen gegen Direktoren und Aufsichtsräte geht. Keiner von denen will vor Gericht stehen. Das ist das Gute an Klagen: Sie sind so unangenehm, dass niemand sie haben will.
Welche Trends lesen Sie aus Ihrer Datensammlung?
In letzter Zeit sehen wir viele Klagen von Jugendlichen. Diese sind zwar zu jung, um zu wählen oder gewählt zu werden, aber sie wollen, dass etwas passiert. Nun verhilft ihnen der Weg über die Gerichte zu einer Stimme. Ein weiterer Trend besteht in Klagen, die wir als «strategisch» bezeichnen. Bei diesen definiert man ganz gezielt, wer klagt, gegen wen man klagt und wo man klagt. Das Ziel ist, Gerichte dazu zu bringen, Präzedenzfälle zu schaffen, die dann auch in anderen Ländern aufgegriffen werden können. Man fordert so die Rechtsdoktrin heraus und zwingt Richter, außerhalb der herkömmlichen Schemata zu denken.

Was war bislang das wichtigste Urteil?
Als wegweisend gilt das Urteil des Obersten Gerichtshofs der Niederlande nach einer Klage der Umweltstiftung «Urgenda». Zum ersten Mal wurde ein Land per Gericht dazu gezwungen, die Emissionen stärker zu senken als geplant. Der Urgenda-Fall hat einen Trend in Gang gesetzt: nicht nur bei Klagen gegen Regierungen, sondern – auf Basis der Sorgfaltspflicht – auch gegen Unternehmen. Ich glaube nicht, dass die deutsche Klimaklage ohne den Urgenda-Präzedenzfall stattgefunden hätte.
Was hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hierzulande Neues gebracht?
Zum einen bestätigt es Deutschlands globale Verpflichtungen. Zum anderen, und das ist das Bemerkenswerteste, berücksichtigt die Entscheidung, wie sich die heutigen Handlungen auf die Grundfreiheiten in der Zukunft auswirken, Stichwort «Generationengerechtigkeit». Dabei wurde nicht nur festgestellt, dass künftige Generationen immer extremeren Klimawandelfolgen ausgesetzt sein werden, sondern auch, dass diese nur noch ein sehr kleines oder gar kein CO2-Budget mehr hätten, wenn wir heute zu viel davon verbrauchen.
Viele Kläger argumentieren, dass ungenügender Klimaschutz die Menschenrechte verletzt. Stimmt das?
Es lässt sich einfach zeigen, dass klimatische Veränderungen das Leben und die Lebensqualität beeinträchtigen und sogar das Recht auf Leben gefährden. Neu ist, dass auch Gerichte anerkennen: «Der Klimawandel gefährdet die Menschenrechte. Das mag offensichtlich erscheinen, aber solange man kein solches Urteil hat, entspricht es eben nicht der Gesetzeslage. Auch hier ist das Urgenda-Urteil wichtig. Denn da wurde zum ersten Mal von einem obersten Gericht bestätigt: Klimaschutz ist eine Pflicht seitens des Staates, das Recht auf Leben zu schützen.
Das Urgenda-Urteil
Die Niederlande müssen ihre Emissionen bis 2030 um 25 Prozent gegenüber 1990 senken – statt nur um 17 Prozent, wie von der Regierung geplant. Dieses historische Urteil von 2015 wurde 2018 auch in zweiter und 2019 in letzter Instanz bestätigt. Geklagt hatte die Umweltstiftung «Urgenda» zusammen mit 900 Bürgern gegen den niederländischen Staat. Die Berufungsgerichte gaben zudem Urgenda recht, dass das 17-Prozent-Ziel der niederländischen Regierung auch gegen die Menschenrechte der Kläger verstößt. Das Verfahren war der erste erfolgreiche Versuch von Klimaschützern, gegen einen Staat zu klagen, um die Reduzierung von Treibhausgasen durchzusetzen.
Foto: Chantal Bekker / GraphicAlert
Nun gibt es aber kein Menschenrecht auf eine saubere Umwelt und ein stabiles Klima. Sollte ein solches Menschenrecht geschaffen werden? Welche Folgen hätte das?
Es dauert ein Jahrzehnt, um europäische oder internationale Abkommen so anzupassen, dass ein solches Menschenrecht geschaffen werden kann. Klagen bieten eine Abkürzung, weil Gerichte feststellen können, dass sich das Recht auf ein stabiles Klima aus anderen Menschenrechten ergibt. Die brasilianische Verfassung beispielsweise garantiert das Recht auf eine saubere Umwelt. Das Recht auf ein stabiles Klima ist allerdings sehr viel umfassender. Daher will eine Klage vor dem obersten brasilianischen Gerichtshof erreichen, dass auch das Recht auf ein stabiles Klima anerkannt wird. Gerichte können über die Verfassung hinausgehen. Das tun sie allerdings nicht immer. In Irland hat ein Gericht geurteilt, dass das irische Klimagesetz zu vage ist, aber auch ausdrücklich festgehalten, dass damit kein Recht auf ein stabiles Klima geschaffen wird. Manchmal sind Gerichte also auch zu zaghaft.
Kommen wir zu den Klagen gegen Großunternehmen: Auch hier stammt das spektakulärste Urteil aus den Niederlanden, wo im Mai ein Gericht in erster Instanz den Öl- und Gaskonzern Shell dazu verurteilte, seine Emissionen bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent zu senken – inklusive derjenigen Emissionen, die bei der Verbrennung der Shell-Produkte freigesetzt werden. Wie erklären Sie sich, dass hier einem einzelnen Konzern Beschränkungen auferlegt wurden?
Staaten sind dazu verpflichtet, die Bürger zu schützen. In diesem Fall wurde diese Verantwortung auf Firmen ausgeweitet. Konzerne wie Shell haben zum Zweck, Gewinne für ihre Aktionäre zu machen und Menschen zu beschäftigen. Das Gericht hat nun entschieden, dass sie darüber hinaus eine Sorgfaltspflicht haben und die Rechte niederländischer Bürger nicht gefährden dürfen.
Aber nutzt das nicht einfach der Konkurrenz?
Shell hat im Prozess natürlich vorgebracht, dass es unfair sei, wenn ihnen Beschränkungen auferlegt werden, die für die Konkurrenten nicht gelten. Doch das Gericht ließ das Argument «Wettbewerbsnachteil» nicht gelten – weil bald alle Unternehmen dieselben Beschränkungen haben würden. Die Begründung des Gerichts ist wegweisend, weil angebliche Nachteile das am häufigsten vorgebrachte Argument in solchen Fällen sind. Und jetzt sagt das Gericht: Das ist nicht relevant.
Es gibt auch Schadensersatzklagen gegen Firmen. Welche Rolle spielt hier die sogenannte Attributionsforschung, die mögliche Schäden beziffert und Verursachern zuordnet?
Bei Klagen auf Schadensersatz ist die Attributionsforschung zentral. Fordert man Unternehmen auf, für etwas zu bezahlen, dann muss man zeigen, worauf diese Forderung beruht und warum man einen ganz bestimmten Betrag verlangt. Nehmen wir den Fall des peruanischen Bauern Saúl Luciano Lliuya, der RWE verklagt. Sein Dorf liegt unterhalb eines Gletschers, welcher wegen der Klimaerwärmung schmilzt. So entsteht ein Gletschersee, der das Dorf unter Wassermassen begraben würde, wenn er über das Ufer tritt. Deshalb benötigt das Dorf Schutzdeiche. Lliuya fordert nun, dass sich RWE mit 0,47 Prozent an den Kosten für diese Deiche beteiligt. Das ist gemäß einer Studie des Wissenschaftlers Richard Heede vom «Climate Accountability Institute» der Anteil von RWE an den globalen Klimagasemissionen seit Beginn der industriellen Revolution. Das Gericht hat nun den Kläger und RWE gebeten, Experten zu benennen, die die Attribution evaluieren. Erkennt hier oder in einem anderen Fall das Gericht die Verbindung zwischen den Emissionen eines Konzerns und einem konkreten Schaden an, würde das weltweit die Schleusentore für eine Flut von Klagen gegen Unternehmen öffnen.
Attributionsforschung
Ist das noch Wetter oder ist das schon Klima? Diese Frage lässt sich bei Extremwetterereignissen wie Hitze- und Kältewellen oder Starkregen immer konkreter beantworten. Zu verdanken ist das einem Teilgebiet der Klimawissenschaften, der Attributions- oder Zuordnungsforschung. Dabei werden die Daten zu einem bestimmten Wetterereignis in zwei Computermodelle des Klimas eingespeist: Das eine Modell rechnet mit der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, wie sie vor der industriellen Revolution herrschte, das andere mit der aktuellen CO2-Konzentration. So lässt sich vergleichen, wie oft ein solches Ereignis früher zu erwarten war und heute zu erwarten ist. Damit kann man aufzeigen, welchen Einfluss die menschengemachten Emissionen auf ein einzelnes Ereignis haben.
Sind auch Schadensersatzklagen aufgrund von Extremwetterereignissen wie den heftigen Überschwemmungen im Ahrtal denkbar?
Ja, natürlich. Dazu muss man darlegen, dass ohne den Klimawandel derart extreme Regenfälle sehr unwahrscheinlich gewesen wären. Auch das leistet die Attributionsforschung. Mit ihr konnte man etwa zeigen, dass die diesjährige Hitzewelle im Nordwesten der USA ohne den Klimawandel «nahezu unmöglich» gewesen wäre. Bei den Überschwemmungen in Deutschland und Belgien ist der Zusammenhang aber nicht so zwingend, wie eine aktuelle Kurzstudie der Wissenschaftler von «World Weather Attribution» zeigt.
Derzeit werden zwei neuartige rechtliche Ansätze zum Schutz der Umwelt diskutiert. Der erste besteht darin, schwere Schädigungen der Umwelt zu einer Straftat zu machen, den «Ökozid» also zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erklären. Wäre das sinnvoll?
Die kurze Antwort ist: Wir haben für all das keine Zeit! Diese Debatte ist sehr alt. Seit 30 Jahren reden wir darüber – und immer noch diskutieren wir, wie eine Formulierung für das Verbrechen des Ökozids genau aussehen soll. Würde die Schädigung der Umwelt allerdings als Verbrechen anerkannt, sendet das natürlich ein starkes Signal an diejenigen, die solche Verbrechen begehen.
Zum Beispiel an Jair Bolsonaro, den Präsidenten Ihres Heimatlands Brasilien?
Bolsonaros Rolle in der Krise im Amazonas zeigt, warum wir strafrechtliche Verantwortlichkeit brauchen. Er ist das beste Beispiel, warum Ökozid ein Verbrechen sein sollte. Bolsonaro macht sich außerdem auch des Genozids schuldig – denn er beschneidet die Landrechte der Indigenen. Es gibt dazu bereits einen Fall vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ich glaube aber nicht, dass das Bolsonaro den Schlaf rauben würde. Vielleicht gefiele es ihm sogar. Viele seiner Unterstützer mögen es, wenn er sagt, die indigene Bevölkerung sei faul und trüge nichts zur Wirtschaft bei – und der Wald würde besser abgeholzt als stehen gelassen. Er wurde auch genau deshalb gewählt, weil er solche Sachen sagt.
Der zweite neue Ansatz besteht darin, die Natur als Rechtsperson anzuerkennen. Dann könnte das Klima selbst gegen die Destabilisierung durch den Menschen klagen. Wäre das sinnvoll?
Ich sehe diese Option ähnlich wie die Diskussion um den Ökozid. Das ist eine spannende Frage für Akademiker, sie wird aber keinen wesentlichen Unterschied machen. Wir retten den Planeten nicht dadurch, dass Berge und Flüsse Rechte bekommen. Neuseeland verlieh ihnen zwar bereits Rechte, wie auch Kolumbien, Ecuador und Bolivien – aber hat die Entwaldung in diesen Ländern deshalb ein Ende gefunden? Nein! Rechte für die Natur stellen eher einen neuen Denkansatz dar: Nicht nur wir Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen besäßen dann per se ein einklagbares Recht auf Existenz. Praktisch zieht das aber hochkomplexe Fragestellungen nach sich. Wer repräsentiert diese Wesen beispielsweise vor Gericht? Spätestens dann geht es wieder nur um uns Menschen.
In Neuseeland wird der «Whanganui River» von einem Rat vertreten, dem das Volk der Maori, der lokale Fremdenverkehrsverein, Umweltorganisationen und ein Energiekonzern, der an dem Fluss ein Wasserkraftwerk betreibt, angehören. Das scheint mir eine sinnvolle Lösung zu sein.
Es ist von Vorteil, wenn man solche Institutionen schafft, denn sie ermöglichen, Menschen in demokratische Prozesse einzubinden. In Brasilien haben zum Beispiel die Einzugsgebiete von Flüssen ihre eigenen Regulierungsbehörden. Das ist sinnvoll, weil man nicht zwischen einzelnen Distrikten unterscheiden kann, die längs eines Flusses liegen. Dafür muss man aber keine Rechtspersonen schaffen.
Gibt es in den bestehenden Regeln zum Schutz der Umwelt und des Klimas noch Lücken?
In den letzten Jahren sind viele neue Akteure zur Klimabewegung gestoßen. Nun wollen auch Konzerne, Banken und Investoren zum Klimaschutz beitragen, die vor zehn Jahren noch äußerst wenig getan haben. Die wollen jetzt «Paris-konform» sein und versprechen, bis zu einem bestimmten Jahr klimaneutral zu werden. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist die Möglichkeit, diese Akteure zur Rechenschaft zu ziehen. Das bedeutet: Man darf die Akteure nicht nur daran messen, was sie versprechen, sondern muss auch genau schauen, was von ihnen tatsächlich in die Tat umgesetzt wird.
Aber diese Versprechen sind doch freiwillig?
Das stimmt, bis vor Kurzem war dies «soft law», also nichts Zwingendes. Aber jetzt haben wir die UN-Prinzipien für Menschenrechte, die sich an Unternehmen richten. Außerdem wurden die OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne entwickelt. Und es gibt erste Urteile wie beim Shell-Fall, die zeigen: Der Schutz von Klima und Umwelt ist zwingend nötig. Unternehmen haben eine Sorgfaltspflicht. Es ist nicht mehr so «soft».
Wie werden sich Klimaklagen in Zukunft entwickeln? Werden wir mehr davon erleben?
Ja. Ich bin sicher, dass die Zahl der Klimaprozesse weiter zunehmen wird. Denn einerseits versteht die Gesellschaft die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels immer besser. Und andererseits sind Gerichte immer genauer über Klimawandelfolgen informiert, erkennen die Dringlichkeit zu handeln und sind deshalb bereit, bei ihren Entscheidungen neue, mutigere Wege zu gehen.
Joana Setzer, 1979 in Brasilien geboren, studierte Rechts- und Umweltwissenschaften in São Paulo und London mit Promotion an der «London School of Economics» (LSE). Sie arbeitete als Umweltanwältin in Brasilien und ist jetzt Assistenzprofessorin am «Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment» an der LSE. Dort ist sie für das Projekt «Climate Change Laws of the World» verantwortlich – einer Datenbank, die Klimaklagen weltweit sammelt und zur Verfügung stellt. Setzer ist derzeit Co-Autorin des dritten Bands des «Sechsten IPCC-Sachstandsberichts», der im März 2022 veröffentlicht werden soll.
-

Das Recht auf Zukunft
Immer mehr junge Menschen ziehen für ein lebenswertes Klima vor Gericht. Eine australische Studentin will so ihre Regierung zu mehr Klimaschutz zwingen.
-

«Wir brauchen eine Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede»
Eine Klimaerwärmung über vier Grad würde die Menschheit existenziell bedrohen. Der Risikoforscher David Spratt fordert daher eine Mobilisierung der gesamten Gesellschaft – wie in einem Krieg.